Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die COP30 beginnt heute in Belém, der Hauptstadt des Amazonasstaates Pará, mit einigen Problemen und vielen Widersprüchen. Zunächst einmal beginnt sie mit einer Klimakatastrophe, die erneut den Süden Brasiliens heimgesucht hat, diesmal den Bundesstaat Paraná. Eine ganze Stadt, Rio Bonito do Iguaçu, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch den Durchzug eines Tornados zerstört, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen und mehr als 700 verletzt wurden – eine Tragödie, die zu den verheerenden Überschwemmungen vom Mai letzten Jahres in Rio Grande do Sul hinzukommt. Die Regierung von Lula, die auf die UN-Klimakonferenz setzt, um der Welt ihre grüne Agenda zu präsentieren, sieht sich nun gezwungen, sich der Realität zu stellen. „Die ärmsten und abgelegensten Gebiete sind in der Regel viel stärker gefährdet. Letztendlich hängen die Schwere und die Sterblichkeitsrate nicht so sehr mit der Intensität des Phänomens zusammen, sondern vielmehr mit dem Ort, an dem es sich ereignet hat”, erklärte der Forscher Daniel Henrique Cândido von der UNICAMP, der Staatlichen Universität von Campinas, gegenüber der Website G1. „Mehr als 80 % der Stadt sind zerstört. Und was viele weiterhin als Einzelfall bezeichnen, ist in Wirklichkeit die x-te Warnung vor der Klimakrise, die das Land weiterhin ignoriert“, erklärte die von der derzeitigen Umweltministerin Marina Silva gegründete Partei Red Sostenibilidad in einer Miutteilung. „Die Tragödie von Paraná ist ein dringender Aufruf zum Handeln, zur Gerechtigkeit und zur Umweltverantwortung“, heißt es abschließend in der Erklärung.
Allerdings wird es wahrscheinlich nicht die COP30 sein, die die Klimakrise in Brasilien löst. Laut einer Umfrage der Plattform Climate Watch haben von den 195 Unterzeichnern des Pariser Abkommens nur 79 ihre nationalen Klimapläne vorgelegt, was 64 % der globalen Treibhausgasemissionen entspricht. Hinzu kommt die geringe Beteiligung an der Veranstaltung aufgrund der gestiegenen Preise. Letztendlich haben nur 160 Länder ihre Teilnahme bestätigt, eine der niedrigsten Zahlen der COP-Veranstaltungen der letzten Jahre. Selbst die COP29 in Aserbaidschan konnte 193 Länder zusammenbringen. Darüber hinaus schwebt über der Veranstaltung die angebliche Bedrohung durch die Comando Vermelho (CV), eine der größten kriminellen Vereinigungen des Landes. Laut einem Dokument des Ministers für Bergbau und Energie, Alexandre Silveira, das am 31. Oktober als Eilpost an das Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit geschickt wurde, ordnete die Gruppierung die sofortige Einstellung der Erweiterungsarbeiten am Umspannwerk Marituba, das Belém versorgt, an und verlangte, dass alle operativen Aktivitäten täglich ab 15 Uhr eingestellt werden. Das Umspannwerk gilt als unverzichtbar für die Sicherstellung der Stromversorgung der Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Marituba und sein Umspannwerk wurden jedoch nicht in die Operation zur Gewährleistung von Recht und Ordnung (GLO) einbezogen, d. h. in das Sonderdekret, mit dem Lula den Einsatz der Streitkräfte zum Schutz der Veranstaltung genehmigte. Um die Spannungen noch zu verschärfen, wurde am 4. November eine Granate in einem Müllcontainer in einem Wohnhaus, ebenfalls in Marituba, gefunden.
Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der letzte Woche in Belém stattfand, galt als Generalprobe für die COP30, die heute beginnt. Abgesehen vom Ausbleiben der Staatschefs – nicht einmal Lulas wichtigster Handelspartner, Chinas Präsident Xi Jinping, war anwesend – zeigte die Veranstaltung viele Probleme auf, darunter unvollendete Bauarbeiten für die COP30, fehlendes Wasser in den Toiletten des Pressebereichs und extrem hohe Lebensmittelpreise auf dem Konferenzgelände. Die letzte Woche in Belém von der Regierung Lula ins Leben gerufene Stiftung „Tropical Forests Forever” (TFFF) wurde ebenfalls kritisiert. Bislang haben nur Norwegen, Brasilien, Indonesien und Frankreich ihre Finanzierung bestätigt und jeweils 3 Milliarden Dollar, 1 Milliarde Oslo und Brasilia sowie 500 Millionen Frankreich zugesagt, während die Niederlande, Deutschland, China und Großbritannien ihre Unterstützung zugesagt haben, ohne jedoch anzugeben, wie viel sie beitragen werden. Ziel der Initiative ist es, 125 Milliarden Dollar aufzubringen, davon 25 Milliarden aus öffentlichen Mitteln und der Rest aus privaten Mitteln, und sie soll von der Weltbank verwaltet werden. Der Mechanismus sieht vor, für jeden Dollar aus öffentlichen Mitteln etwa 4 Dollar pro Hektar privat geschützten Waldes auszuzahlen, ähnlich wie beim Amazonas-Fonds.
Zunächst weist das Land die erzielten Ergebnisse im Bereich Naturschutz nach und erhält dann die Belohnung. Schließlich werden etwa 20 % der Mittel für indigene Völker und lokale Gemeinschaften bereitgestellt. Aber es mangelt nicht an Kritik. „Der Wert pro Hektar ist sehr niedrig ausgefallen”, erklärte Tasso Azevedo, Gründer der Nichtregierungsorganisation MapBiomas und ehemaliger Direktor des brasilianischen Forstdienstes, gegenüber der Zeitung Folha de São Paulo. Es war genau Azevedo, der Lula vor zwei Jahren die ursprüngliche Version des Vorschlags vorstellte. Dieser sah vor, dass die Ölindustrie einen Dollar pro produziertem Barrel Öl zahlen sollte, was den lokalen Gemeinden eine höhere Zahlung garantiert hätte. „Der aktuelle Wert reicht nicht aus, um die Wirtschaft, die zur Abholzung beiträgt, zu bremsen”, erklärte Azevedo. Das Modell wurde auch vom Forscher Max Alexander Matthey und Professor Aidan Hollis von der Universität Calgary in Kanada kritisiert. Beide sind der Meinung, dass der Mechanismus die Risiken des Finanzmarktes unterschätzt und die Wälder benachteiligt, da die Zahlungen hierarchisch erfolgen, zuerst an private Investoren, dann an die Länder und erst am Ende an diejenigen, die für den Erhalt der Wälder leben und arbeiten. In Zeiten finanzieller Instabilität könnte dieser letzte Teil der Kette benachteiligt werden.
In diesen Stunden hat auch der Australier Andrew Forrest, der mit dem Bergbau zum Multimillionär wurde und sich dann, ohne diesen aufzugeben, der grünen Energie zuwandte, seine Hilfe bei der Beschaffung von Geldern angeboten. „Viele bleiben jedoch skeptisch, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum“, schrieb Time in einem ihm gewidmeten Profil im vergangenen Februar. „Die Bergbauindustrie ist eine der umweltschädlichsten Industrien der Welt und für mehr als 5 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Hinzu kommen lokale Auswirkungen wie Luftverschmutzung, die den umliegenden Gemeinden schadet, und Bedenken hinsichtlich der Landrechte, da Bergbauaktivitäten oft in indigenen Gebieten stattfinden“, schließt das US-Wochenmagazin. Unterdessen bitten viele Landwirte im Bundesstaat Pará um Hilfe, um zum Kampf gegen die Entwaldung beitragen zu können, wie beispielsweise diejenigen in der Region Tomé-Açu, 180 km von der Hauptstadt Belém entfernt, in die im letzten Jahrhundert zahlreiche japanische Einwanderer kamen. Einer ihrer Nachkommen, Alberto Ke Iti Oppata, ist heute Direktor der Cooperativa Agrícola Mixta de Tomé-Açu (Camta). „Wir brauchen eine flexiblere und schnellere Kreditlinie, um den Familienbauern zu helfen. Denn heutzutage reicht es nicht mehr aus, Finanzmittel für Investitionen zu erhalten“, erklärt Oppata.
„Unsere Genossenschaft besteht hier seit 93 Jahren, während wir gerade das 96-jährige Jubiläum der japanischen Einwanderung in die Region gefeiert haben. In den letzten 96 Jahren haben wir den Klimawandel am eigenen Leib erfahren und einen Temperaturanstieg von mehr als einem Grad festgestellt”. Oppata erinnert daran, dass seine Genossenschaft 2024 die schlimmste Dürre in der Region erlebte, wobei es in einigen Gebieten sechs Monate lang nicht regnete. Die Situation war so ernst, dass es aufgrund von Blitzen oder anderen Funken zu Bränden kam. „Wie kann dieses Problem gelöst werden? Durch Bewässerung, damit Kleinbauern über Finanzierungslinien für Bewässerungsanlagen Zugang zu Krediten erhalten. Aber es gibt das Problem der Wasserrechte und Umweltgenehmigungen, denn hier gibt es eine Gesetzgebung, die festlegt, dass diejenigen, die dies bereits vor 2008 getan haben, bis zu 50 % der Flächen bewirtschaften dürfen; in anderen Gebieten sind es 20 %, d. h. 80 % des Waldes müssen erhalten bleiben und nur 20 % dürfen bewirtschaftet werden. Das bedeutet, dass von 20 Hektar nur 4 Hektar bewirtschaftet werden dürfen. Das Problem ist, dass niemand seine Familie mit 4 Hektar ernähren kann”, so Oppata. In den Bundesstaaten des Amazonasgebiets gibt es auch Bedenken wegen der Ölbohrungen an der Mündung des Amazonas, die Lula unterstützt und die kürzlich nach jahrelangen Auseinandersetzungen von der brasilianischen Umwelt- und Naturschutzbehörde IBAMA genehmigt wurden. Trotz der Befürchtungen hinsichtlich möglicher ökologischer und sozialer Schäden für die lokale Bevölkerung erklärte Umweltministerin Marina Silva, dass „die Idee von Präsident Lula, einen Teil der Ölgewinne für die globale Energiewende und die Förderung der Klimagerechtigkeit zu verwenden, sehr interessant ist”. „Die Logik, die Einnahmen aus fossilen Brennstoffen zur Finanzierung der Energiewende zu verwenden, hält das System am Leben. Wir müssen sie stoppen und nicht mit neuen Slogans neu erfinden”, entgegnete Natalie Unterstell, Präsidentin des Forschungszentrums für Klimapolitik Instituto Talanoa.
Während des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs saß Marina Silva immer in der zweiten Reihe, obwohl sie als Umweltministerin symbolisch eine zentrale Rolle spielte. Die Tatsache, dass Lulas Ehefrau Rosangela da Silva, bekannt als Janja, neben ihrem Mann in der ersten Reihe saß, blieb nicht unbemerkt. „Janja hatte mehr Bedeutung (…) Marina Silva genoss nicht das gleiche Ansehen wie Janja und saß in der zweiten Reihe”, kommentierte die Nachrichtenwebsite Poder360. Die First Lady wurde auch für die luxuriöse Yacht kritisiert, auf der sie und ihr Mann während des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Woche untergebracht waren, eine Ausgabe, die der Präsidentenpalast Planalto bestätigt hat. Der in Brasilien hergestellte Motor der Yacht verbraucht 50 Liter Diesel pro Stunde. Der Kraftstoff gilt als einer der umweltschädlichsten. Das Schiff fährt mit einer Geschwindigkeit von 20 bis 30 km/h. Die Strecke zwischen den beiden Hauptstädten am Amazonas beträgt 1.650 km zwischen Belém und Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas. Unter Berücksichtigung der 5 Tage für die Hinfahrt und der 7 Tage für die Rückfahrt dürfte der Verbrauch laut Poder360 bei etwa 4.000 Litern Diesel liegen.
Neben der Bedeutung des Erdöls für Brasilien hat ein weiteres Thema die Widersprüche in Lulas grüner Agenda deutlich gemacht. Tatsächlich hat das lateinamerikanische Land bis zum Beginn der COP30 seinen nationalen Aktionsplan zur Reduzierung oder Beseitigung von Quecksilber, einem giftigen Metall aus dem Bergbau, nicht vorgelegt, obwohl dieser Plan bereits seit fünf Jahren überfällig ist. Die brasilianische Regierung wird sich in den nächsten Tagen darauf beschränken, einen Plan für den Bereich der Zahnmedizin anzukündigen, der eine schrittweise Reduzierung von Amalgam bis 2030 vorsieht. Erst letzte Woche fand in Genf, Schweiz, die 6. Konferenz der Vertragsparteien des Minamata-Übereinkommens in Japan statt, auch bekannt als COP6, bei der sich die brasilianische Regierung darauf beschränkte, internationale Mittel zur Bekämpfung der Verwendung von Quecksilber im meist illegalen handwerklichen Goldbergbau zu beantragen, ohne einen Plan vorzulegen. Quecksilber wird verwendet, um Goldpartikel von Verunreinigungen zu trennen, ist jedoch sehr schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Minamata-Übereinkommen, das seit 2017 in Kraft ist, verbietet die Eröffnung neuer Quecksilberminen, legt Fristen für die schrittweise Einstellung seiner Verwendung in Produkten wie Lampen, Batterien und Thermometern fest und verpflichtet die Länder, Pläne zur Begrenzung seiner Verwendung im handwerklichen und kleinräumigen Goldbergbau zu entwickeln.
Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Instituto Escolhas wurden in den letzten fünf Jahren 185 Tonnen illegales Quecksilber im Land verwendet. Derzeit werden die Kontrollen in Brasilien ausschließlich aus nationalen Mitteln finanziert. Für das Volk der Yanomami beispielsweise hat die Regierung in drei Jahren 8 Millionen Real (1,5 Millionen Dollar) ausgegeben, aber ein strukturiertes Projekt würde etwa 5 Millionen Dollar pro Jahr erfordern. Ministerin Marina Silva hat versucht, ihr Ministerium zum Bezugspunkt für die Koordinierung des Plans zu machen, jedoch ohne Erfolg. Derzeit liegt die Ausarbeitung weiterhin in den Händen des Ministeriums für Bergbau und Energie.

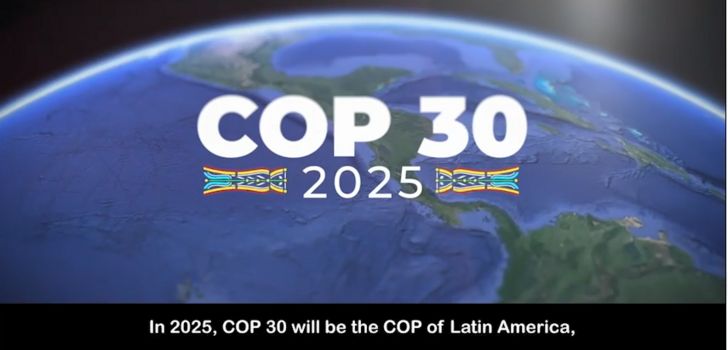
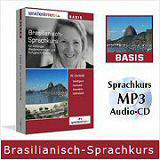







































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!