Während die Augen der Welt auf Belém und die COP 30 gerichtet sind, steht Lateinamerika an einem entscheidenden Punkt in seiner Energie- und Klimapolitik. Die Region wird oft für ihren Reichtum an erneuerbaren Energiequellen – Wasserkraft, Solar- und Windenergie – gelobt, aber unter dieser „grünen” Oberfläche besteht ein Paradoxon: Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die Entwaldung und die tiefen sozialen Ungleichheiten prägen weiterhin die Energielandschaft. Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind die lateinamerikanischen Länder im Rahmen des Pariser Abkommens mutige Verpflichtungen eingegangen und haben ihre national festgelegten Beiträge (NDCs) vorgelegt und aktualisiert. Die meisten haben versprochen, erneuerbare Energiequellen auszubauen und bis Mitte des Jahrhunderts CO2-Neutralität zu erreichen. Wie wir jedoch in der Studie „Climate commitments and energy transition pledges in Latin America: Where is the region headed?” sehen, bestehen diese Verpflichtungen oft neben einer Politik, die weiterhin Öl, Gas und Bergbau begünstigt – ein „extraktivistisches Paradoxon”, das einen Großteil des Entwicklungsmodells der Region prägt.
Die lateinamerikanische Energiewende geht weit über den einfachen Ersatz fossiler Brennstoffe durch Sonnenkollektoren oder Windkraftanlagen hinaus. Es handelt sich vielmehr um einen Konflikt zwischen verschiedenen Entwicklungsmodellen, Regierungsformen und Vorstellungen von Gerechtigkeit. Während Länder wie Chile, Brasilien und Uruguay sich als Vorreiter im Bereich der erneuerbaren Energien hervorgetan haben, sind andere weiterhin stark von fossilen Brennstoffen abhängig. Selbst saubere Energien wie Wasserkraft sind zunehmend durch Dürren, soziale Konflikte und die Zerstörung von Ökosystemen bedroht. Im Zentrum dieser Herausforderung steht eine historische Abhängigkeit vom Extraktivismus – der großflächigen Ausbeutung natürlicher Ressourcen für den Export. Ob in Ölfeldern, Lithiumminen oder Sojaplantagen: Der Extraktivismus hat das Wirtschaftswachstum gestützt, aber auch Ungleichheiten und Umweltzerstörung verschärft. Die neue „grüne” Wirtschaft läuft Gefahr, diese Muster unter einem neuen Deckmantel zu reproduzieren, dem sogenannten Neo-Extraktivismus, da globale Mächte um die für erneuerbare Technologien unverzichtbaren kritischen Mineralien der Region konkurrieren.
Da die COP 30 im Amazonasgebiet stattfindet, wird dieser Widerspruch noch symbolischer. Brasilien hat die Klimapolitik wieder zu einer nationalen Priorität gemacht, indem es das Sekretariat für Energiewende eingerichtet, die Nationale Politik für Energiewende ins Leben gerufen und ehrgeizige Dekarbonisierungsziele angekündigt hat. Neue Explorationsprojekte im Amazonasbecken zeigen jedoch, dass wirtschaftliche Zwänge nach wie vor mit ökologischen Grenzen kollidieren. Der Wald, der die globale Hoffnung auf Klimaschutz symbolisieren sollte, ist weiterhin durch dasselbe Entwicklungsmodell bedroht, das die Energiewende zu überwinden vorgibt. Diese Spannung wiederholt sich in ganz Lateinamerika. Obwohl die Regierungen den Diskurs des „grünen Wachstums” übernehmen, unterstützen sie weiterhin extraktive Strukturen, die seit Jahrzehnten Ungleichheit, Abhängigkeit und Opferzonen hervorbringen. Öl-, Gas- und Bergbauprojekte werden weiter ausgebaut und nun als Säulen der „grünen Wirtschaft” bezeichnet. Diese neue Rhetorik läuft Gefahr, zu einer Tarnung für den alten Extraktivismus zu werden – nachhaltig im Diskurs, aber basierend auf derselben Logik der Ausbeutung.
Blick in die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen
Um zu verstehen, warum dieser Wandel so schwierig ist, muss man einen Blick auf die historische Entwicklung der Region werfen. In den 1960er und 1970er Jahren übernahmen viele lateinamerikanische Regierungen die Idee, dass „die schlimmste Umweltverschmutzung die Armut ist”. Wirtschaftswachstum wurde als Weg zu sozialem Fortschritt und letztlich zu einer Verbesserung der Umwelt propagiert. Das lateinamerikanische Weltmodell der Bariloche-Stiftung, das als Antwort auf den Bericht „Die Grenzen des Wachstums” des Club of Rome entwickelt wurde, brachte eine differenziertere Kritik auf den Punkt: Es argumentierte, dass die wahren Grenzen des Planeten institutioneller und verteilungspolitischer Natur seien und in globaler Ungleichheit und ungerechten Machtstrukturen begründet lägen – und nicht in der physischen Kapazität der Natur. Aus dieser Perspektive war die Umweltzerstörung kein unvermeidliches Ergebnis der Entwicklung, sondern ein Spiegelbild sozialer und politischer Ungleichheiten.
Diese Logik wurde auf der Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt 1972 in Stockholm deutlich, als mehrere lateinamerikanische Delegationen – insbesondere Brasilien – das Recht auf Industrialisierung verteidigten und argumentierten, dass Umweltbelange das Wachstum nicht einschränken sollten. Die damalige brasilianische Militärregierung ging sogar so weit, umweltverschmutzende Industrien aus Industrieländern einzuladen, sich im Land anzusiedeln, und präsentierte es als ein Gebiet mit „Raum für Entwicklung”. Im Laufe der Zeit wurde diese Sichtweise jedoch verzerrt und instrumentalisiert. Politische und wirtschaftliche Eliten reduzierten die Botschaft von Bariloche auf eine Rechtfertigung für die Vorrangstellung des Wirtschaftswachstums und nutzten die Bekämpfung der Armut als Argument, um entschlossenere Umweltmaßnahmen aufzuschieben. So wurde eine ursprünglich auf sozialer Gerechtigkeit und institutionellen Reformen basierende Vision in eine Verteidigung des Wachstums um jeden Preis umgewandelt, die das Entwicklungsparadigma der Region prägte und die Abhängigkeit verstärkte, die noch heute ihre Umwelt- und Energiepolitik bestimmt.
Emissionen: Fortschritte mit anhaltenden Anomalien
Forschungen zeigen diesen Widerspruch in den Emissionstrends. Das lateinamerikanische Profil der Treibhausgase (THG) weicht stark vom globalen Muster ab. Während weltweit die Emissionen vom Energiesektor dominiert werden, machen in Lateinamerika die Landwirtschaft und Veränderungen in der Landnutzung – insbesondere die Entwaldung – nach wie vor einen großen Teil der Emissionen aus. Zwischen 1990 und 2021 sanken die Pro-Kopf-Emissionen aus Landnutzung und Forstwirtschaft (LUCF) von 3,65 tCO₂e auf 1,23 tCO₂e, was einen deutlichen Rückgang darstellt, aber immer noch weit über dem globalen Durchschnitt von 0,17 tCO₂e liegt. Die Energieemissionen stiegen hingegen von 2,57 tCO₂e im Jahr 1990 auf 2,64 tCO₂e im Jahr 2021, was die Schwierigkeit verdeutlicht, Wirtschaftswachstum und den Verbrauch fossiler Brennstoffe voneinander zu trennen.
Dies bezeichnen Forscher als die lateinamerikanische „Emissionsanomalie”: eine Region, die gleichzeitig erneuerbar und kohlenstoffintensiv ist, in der Wasserkraftwerke und Bioenergie neben Abholzung, Ölförderung und Emissionen aus dem Verkehrssektor existieren. Der Fall Brasiliens ist illustrativ. Laut der 13. Ausgabe des SEEG (System zur Schätzung von Treibhausgasemissionen und -entfernungen) hat das Land seine Emissionen um 41 % reduziert, was einen bedeutenden Fortschritt darstellt, aber immer noch hinter dem im Pariser Abkommen festgelegten Ziel von 48 % zurückbleibt. Der Anstieg der Emissionen im Energiesektor im Jahr 2024 deutet darauf hin, dass in diesem Bereich noch Handlungsbedarf besteht, um das Wirtschaftswachstum mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.
Politik und Institutionen: hohe Ambitionen, schwache Umsetzung
Seit den 1990er Jahren haben fast alle Länder der Region Umweltministerien eingerichtet, nationale Klimagesetze verabschiedet und ihre NDCsvorgelegt. Diese institutionelle Architektur zeugt von politischem Willen, doch ihre Umsetzung ist nach wie vor schwach. Mangelhafte Überwachung, fragmentierte Regierungsführung und kurze politische Zyklen beeinträchtigen die Konsistenz der Klimaschutzmaßnahmen. Viele Strategien sind unverbindlich oder hängen von unterfinanzierten Institutionen ab. Regierungswechsel, Finanzkrisen und ideologische Rückschläge erschweren die langfristige Planung. Das Ergebnis ist eine Region, die reich an Verpflichtungen, aber arm an Kontinuität ist, in der institutionelle Fortschritte mit struktureller Instabilität einhergehen. Diese Fragilität ist besonders in den Amazonasländern sichtbar, wo politische Entscheidungen die Umweltkrise verschärft haben.
In Brasilien haben Budgetkürzungen und die Schwächung von Behörden wie IBAMA die Abholzung, den illegalen Bergbau und die Landbesetzung begünstigt, die oft von lokalen Eliten toleriert werden. In Bolivien und anderen Ländern haben Maßnahmen zur Ausweitung der Landwirtschaft – insbesondere des Sojaanbaus und der Viehzucht – die Abholzung und Brände in sensiblen Gebieten verstärkt. In anderen Teilen des Amazonasgebiets, wie beispielsweise in Peru, hat die Abwesenheit des Staates Raum für Umweltkriminalität und räuberische Ausbeutung geschaffen. Diese Trends zeigen, dass die Klimapolitik in Lateinamerika sowohl eine politische als auch eine institutionelle Herausforderung darstellt. Regierungen priorisieren häufig Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der Exporte und lockern Umweltschutzauflagen, um Investitionen anzuziehen. Infolgedessen schwankt die Politik zwischen rhetorischen Ambitionen und Abhängigkeit vom Rohstoffabbau.
Verpflichtungen zur Energiewende: zwischen Innovation und Rohstoffabbau
Lateinamerika wird oft als aufstrebender Vorreiter im Bereich der sauberen Energie dargestellt. Sein Strommix besteht bereits zu etwa 60 % aus erneuerbarenEnergien, und Länder wie Uruguay, Chile und Brasilien sind zu Vorreitern in den Bereichen Wind-, Solar- und Biokraftstoffe geworden. Allerdings sind Verkehr und Industrie zusammen für 67 % der energiebezogenen CO₂-Emissionen verantwortlich – also genau die Sektoren, in denen Veränderungen am schwierigsten sind. Der Verkehrssektor allein verursacht 41 % der gesamten CO₂-Emissionen, was auf den vorherrschenden Güterkraftverkehr und den Einsatz von Fahrzeugen mit fossilenBrennstoffen zurückzuführen ist. Daher sind Investitionen in Elektromobilität, öffentlichen Nahverkehr und nachhaltige Logistik unerlässlich. Industrieemissionen erfordern wiederum politische Maßnahmen, die Effizienz, sauberere Produktion und Modelle der Kreislaufwirtschaft fördern.
Die Energiewende in Lateinamerika bleibt jedoch weiterhin in der Hand der fossilen Brennstoffindustrie, die nach wie vor einen starken politischen Einfluss hat und enorme Investitionen konzentriert. Öl und Gas sind weiterhin die fiskalischen Säulen vieler Volkswirtschaften und verstärken damit eine Pfadabhängigkeit, die die Dekarbonisierung verlangsamt. Staatliche Unternehmen, private Investoren und sogar multilaterale Organisationen – wie die OLADE, die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) und andere Institutionen – fördern häufig Erdgas als „Übergangsbrennstoff” und legitimieren damit neue Investitionen in fossile Brennstoffe unter dem Deckmantel des schrittweisen Wandels. Obwohl diese Strategie als pragmatisch dargestellt wird, könnte sie die Region in einer weiteren Generation kohlenstoffintensiver Infrastruktur gefangen halten und Ressourcen von dringenden strukturellen Veränderungen abziehen – wie mutigeren Innovationspolitiken, langfristigen Industriestrategien und technologischen Fortschritten in den Bereichen Energiespeicherung, Energieeffizienz, Elektrifizierung des Verkehrs und Dekarbonisierung der Schwerindustrie.
Darüber hinaus vertieft die technologische Abhängigkeit die Anfälligkeit der Region: Der Großteil der für den Übergang erforderlichen Technologien – von Solarzellen bis hin zu Batterien – wird nach wie vor importiert, wodurch Ungleichgewichte fortbestehen und die Entwicklung lokaler Kapazitäten eingeschränkt wird. Gleichzeitig nimmt der Abbau von Lithium, Kupfer und Nickel zu – Ressourcen, die für saubere Technologien unerlässlich sind, aber häufig mit sozialen und ökologischen Konflikten in Verbindung gebracht werden. Dieses als „grüner Extraktivismus” bekannte Phänomen wiederholt das alte Muster des Exports von Rohstoffen und des Imports von Mehrwert und reproduziert die historische Logik der Abhängigkeit und Ungleichheit unter einem neuen Diskurs der Nachhaltigkeit. Selbst innerhalb der Agenda für erneuerbare Energien läuft Lateinamerika Gefahr, historische Ungleichheiten zu reproduzieren: einen Übergang, der von mächtigen Sektoren vorangetrieben wird, exportorientiert ist und nichts mit sozialer Inklusion zu tun hat. Zum Beispiel zeigt Chiles Fokus auf den Export von grünem Wasserstoff, wie die Strategie der Region im Bereich erneuerbare Energien häufig die Auslandsnachfrage auf Kosten der internen Energiegerechtigkeit und -zugänglichkeit priorisiert.
COP 30: Ein symbolischer Wendepunkt für die Region?
Die COP 30 mit Sitz in Belém im Amazonasgebiet hat eine besondere und zutiefst symbolische Bedeutung. In diesem Zusammenhang steht Lateinamerika vor einem historischen Wendepunkt: Wird es seinen Weg der Ausbeutung und Ausgrenzung fortsetzen oder wird es den Mut haben, einen neuen Weg einzuschlagen, der Ökosysteme, Vielfalt und soziale Gerechtigkeit über unmittelbare und kurzfristige Gewinne stellt? Dieser Übergang bedeutet nicht, auf Entwicklung zu verzichten, sondern die Art und Weise, wie sie erreicht wird, grundlegend zu überdenken. Es ist an der Zeit, nachhaltige Geschäftsmodellezu fördern, die natürliche Ressourcen – Wälder, Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen – als Säulen einer neuen lateinamerikanischen Wirtschaft anerkennen und wertschätzen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, Wohlstand zu schaffen, ohne die Grundlage, auf der er beruht, zu zerstören, indem Innovation, grüne Finanzen, Bioökonomie und inklusive Wertschöpfungsketten gefördert werden, die von einer neuen unternehmerischen und institutionellen Mentalität geleitet werden.
Die zentrale Frage ist nicht nur die Geschwindigkeit des Übergangs, sondern auch sein Zweck: Welche Art von Übergang bauen wir auf – und für wen? Welche Art von Zukunft planen wir tatsächlich? Energie für was und für wen? Die Antwort wird zeigen, ob die Region in der Lage sein wird, ihre historische Abhängigkeit zu durchbrechen und ihr natürliches Erbe in einen strategischen Vorteil zu verwandeln, oder ob sie weiterhin an einem Modell festhalten wird, das Fortschritt verspricht, während es Ungleichheit und Umweltzerstörung reproduziert. Das Dilemma besteht darin, ob Lateinamerika eine neue Ära der nachhaltigen Entwicklung anführen wird oder ob es zulassen wird, dass der sogenannte „Übergang” nur zu einem neuen Namen für den alten Extraktivismus wird.

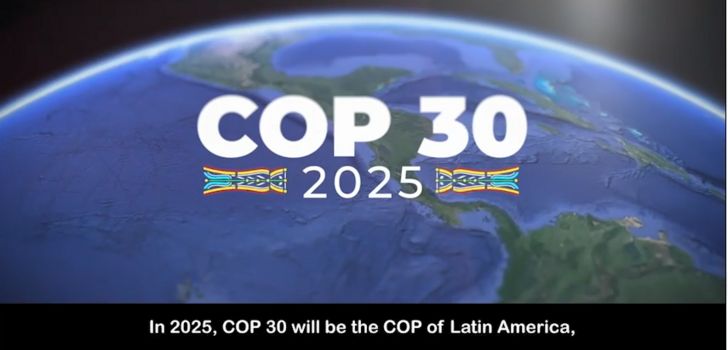
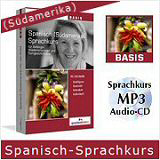








































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!