Der diesjährige UN-Klimagipfel endete mit einem fragilen Kompromiss, der die wichtigsten Forderungen der meisten Länder außer Acht ließ, mit einer Ausnahme: Die reichen Länder verpflichteten sich, ihre Ausgaben zu verdreifachen, um anderen Ländern bei der Anpassung an die globale Erwärmung zu helfen. Hier sind einige der wichtigsten Erkenntnisse aus dem COP30-Klimagipfel, der in der brasilianischen Amazonasstadt Belém stattfand:
ABHÄNGIG VON KOHLENWASSERSTOFFEN
Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte den Gipfel mit der Forderung eröffnet, dass sich die Länder auf einen „Fahrplan” zur Umsetzung der COP28-Verpflichtung zur Abkehr von fossilen Brennstoffen einigen sollten. Auf diesem Gipfel war dies jedoch ein Weg ins Nirgendwo, da die ölreichen arabischen Staaten und andere von fossilen Brennstoffen abhängige Länder jede Erwähnung des Themas blockierten. Stattdessen erstellte die COP30-Präsidentschaft einen freiwilligen Plan, den die Länder unterzeichnen konnten – oder auch nicht. Das Ergebnis war ähnlich wie bei der COP27 in Ägypten und der COP29 in Aserbaidschan, wo sich die Länder darauf einigten, mehr Geld für die Bekämpfung der Klimagefahren auszugeben, während sie deren Hauptursache ignorierten.
Fast drei Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen seit 2020 stammen aus Kohle, Öl und Gas. Die Nachfrage nach diesen Brennstoffen wird laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur, der in der Mitte des COP30-Gipfels veröffentlicht wurde, bis 2050 voraussichtlich steigen, was die Erwartungen einer raschen Umstellung auf saubere Energie zunichte machte.
GLOBALE KLIMAEINIGKEIT AM RANDE
Die Notwendigkeit, bei den Klimaverhandlungen globale Einigkeit zu zeigen, war der wichtigste Punkt, auf den sich die Länder einigten, zusammen mit der Idee, dass die seit langem umweltverschmutzenden reichen Länder am meisten zur Lösung des Problems beitragen sollten. Um jedoch zu einer endgültigen Einigung zu gelangen, gaben sie fast alle ihre ursprünglichen Ambitionen auf – einschließlich der verbindlichen Verschärfung der Ziele zur Reduzierung der klimaschädlichen Emissionen. Der brasilianische COP30-Vorsitz beklagte die Zurückweisung der Gespräche durch die Vereinigten Staaten. Die Abwesenheit der größten Volkswirtschaft der Welt – und des größten historischen Umweltverschmutzers – ermutigte Länder mit Interessen im Bereich fossiler Brennstoffe. Die laut werdenden Bedenken über einen Prozess, der es nur wenigen ermöglicht, kollektive Vereinbarungen effektiv zu blockieren, wurden immer lauter und schürten Forderungen nach Reformen. Nachdem Brasilien eine „COP der Wahrheit” versprochen hatte, die die Länder auf den Weg zum Handeln bringen sollte, war das Fehlen jeglicher vereinbarter Umsetzungspläne eklatant.
CHINA IN POLE-POSITION
China spielte auf dem Gipfel eine führende Rolle – allerdings hinter den Kulissen. Präsident Xi Jinping blieb den Gesprächen wie üblich fern. Seine Delegation überbrachte jedoch eine deutliche Botschaft, dass China bereit sei, die saubere Energietechnologie zu liefern, die die Welt zur Reduzierung der Emissionen benötigt. Führungskräfte chinesischer Solar-, Batterie- und Elektrofahrzeugunternehmen waren im Ausstellungspavillon des Landes zu sehen – einer der ersten Anlaufpunkte für die Delegierten beim Betreten des weitläufigen Veranstaltungsortes. China war nicht das einzige schnell wachsende Land, das in diesem Jahr im Fokus stand. Die indische Delegation zeigte sich in den Verhandlungen stärker, während Südafrika eine klimabezogene Agenda für seinen eigenen G20-Gipfel am 22. und 23. November vorstellte.
UNSICHERE ZUKUNFT FÜR WÄLDER UND INDIGENE RECHTE
Mit der Ausrichtung des Gipfels in einer Stadt im Amazonas-Regenwald betonte Brasilien die Bedeutung der verbleibenden Waldflächen für den Kampf gegen den Klimawandel – ebenso wie die Bedeutung der rund eine halbe Milliarde indigener Menschen, die als Hüter der Natur angesehen werden. Viele Teilnehmer aus dem Amazonasgebiet und der ganzen Welt waren frustriert darüber, dass sie nicht gehört wurden. Sie organisierten mehrere Proteste und stürmten sogar die Tore des COP30-Geländes, wo es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kam, bevor sie zurückgedrängt wurden. Die Länder kündigten Finanzhilfen für den Waldschutz in Höhe von rund 9,5 Milliarden US-Dollar an – darunter fast 7 Milliarden US-Dollar für Brasiliens Vorzeigeprojekt, den Tropenwaldfonds, und weitere 2,5 Milliarden US-Dollar für eine Initiative für den Kongo. Für viele endete der Gipfel jedoch mit einem bitteren Nachgeschmack, da die Verhandlungsführer ihre Bemühungen um einen Fahrplan zur Erfüllung der Zusage, bis 2030 die Entwaldung zu stoppen, aufgaben und den Schutz ihrer Gebiete nicht anerkannten.
ANGRIFFE AUF DIE KLIMAWISSENSCHAFT
Während Lula und andere Staats- und Regierungschefs gegen Fehlinformationen und Leugnung wetterten, trugen die COP30-Gespräche nicht viel dazu bei, dem diesjährigen Angriff der US-Regierung auf die Klimawissenschaft entgegenzuwirken. Der Gipfel untergrub auch den globalen Konsens in Bezug auf die Klimawissenschaft, indem er den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimawandel der Vereinten Nationen nicht mehr als die „beste verfügbare Wissenschaft” anerkannte, die als Leitfaden für die Politik zum Klimawandel und seinen Auswirkungen dient. Stattdessen wird in der endgültigen Vereinbarung die Bedeutung der IPCC-Ergebnisse zusammen mit „den in Entwicklungsländern erstellten Ergebnissen und relevanten Berichten regionaler Gruppen und Institutionen” hervorgehoben. Und indem fossile Brennstoffe und Emissionsziele ausgeklammert wurden, ignorierte die COP30 die Alarmglocken, die von Wissenschaftlern geläutet wurden.

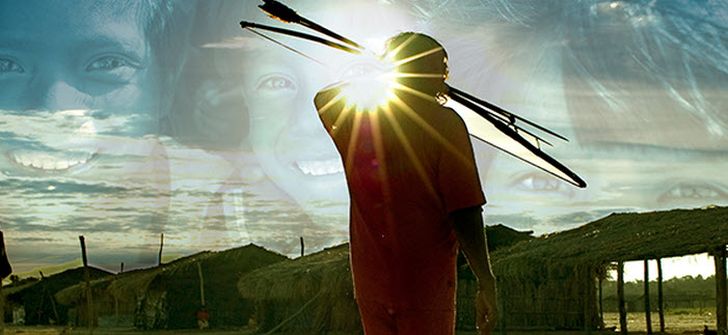
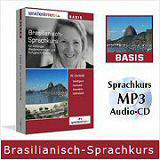








































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!