In der peruanischen Hauptstadt Lima leben 1,7 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Natürlich ist das Problem in dieser Stadt mitten in der Wüste historisch bedingt, aber es nimmt weiter zu. Diejenigen, die keinen Zugang zum Netz haben – fast fünfzehn Prozent der Bevölkerung – müssen Wasser von Tankwagen kaufen, das jedoch nicht immer sicher zu trinken ist. Hinzu kommt, dass im Winter die Straßen in die Berge, wo sich die ärmsten Siedlungen befinden, schlammig werden und wochenlang nicht befahrbar sind. In Venezuela hat die Trinkwasserknappheit sogar den Sprachgebrauch neu definiert. Die Tageszeit, zu der das Wasser eintrifft, wird „la hora loca“ (die verrückte Stunde) genannt, da die ganze Familie herbeieilt, um es zu holen und zu benutzen. Wassermangel ist in einer Gesellschaft, in der es an Problemen nicht mangelt, zur Hauptsorge geworden. Manche sehen darin sogar eine der Hauptursachen für die Auswanderung, denn man kann vieles ertragen, aber ohne Wasser kann man nicht leben. „Die größte Sensibilität bei den Umfragen, die wir durchführen konnten, zeigt sich bei der Trinkwasserversorgung. Es ist diejenige, die am meisten Unbehagen und eine Verschlechterung der Lebensqualität verursacht“, erklärt José María de Viana, Ingenieur, Universitätsprofessor und ehemaliger Präsident von Hidrocapital, dem staatlichen Unternehmen, das für diese Dienstleistung in Caracas zuständig ist.
De Viana verweist auf die Verschlechterung der Unternehmen und der Infrastruktur als Ursache für die gravierenden Engpässe, die sogar dazu geführt haben, dass ganze Stadtteile monatelang ohne Trinkwasser waren. „Wir haben eine wunderbare Infrastruktur, aber in beklagenswertem Zustand. Sie ist nur zu vierzig Prozent ausgelastet und es gibt einen Verlust an Humankapital, an Fachkräften, die in anderen Ländern einen Beitrag leisten, dies aber in Venezuela nicht mehr tun können“, erklärt er. Und es kommt nicht nur wenig Wasser durch die Leitungen, sondern auch noch mit ernsthaften Zweifeln an seiner Qualität. „Die Leute wissen, dass es wegen seiner Trübung, seines Geruchs und seiner Schwebstoffe nicht trinkbar ist“, sagt der ehemalige Geschäftsführer. Für De Viana „werden wir an dem Tag, an dem die Venezolaner sauberes und kontinuierliches Wasser aus ihren Wasserhähnen bekommen, die Hoffnung erneuern, dass sich das Land zum Besseren wenden wird“.
Die Wasserknappheit in Lateinamerika betrifft nicht nur periphere Siedlungen oder trockene ländliche Gebiete, sondern hat sich auf städtische Zentren und Regionen ausgebreitet, die sich vor einigen Jahrzehnten noch niemand hätte vorstellen können. Wasserknappheit ist nicht nur auf Dürre zurückzuführen, sondern auch auf eine schlechte Bewirtschaftung der Ressource, eine nicht gewartete Infrastruktur, Verschmutzung oder darauf, dass das Wasser in privater Hand ist. Chile ist ein extremes Beispiel. In diesem Land erlaubte das Gesetz, vor allem während der Diktatur, Privatpersonen den kostenlosen und unbefristeten Erwerb von Wasserrechten, was viele für absurd halten. Diese Rechte werden selbst in Zeiten der Verknappung zu Preisen in Millionenhöhe verkauft. Zu den Hauptabnehmern zählen Bergbau- und Landwirtschaftsunternehmen. Die Gemeinde Petorca in der Region Valparaíso ist gleich doppelt betroffen. Die Kritik richtet sich einerseits gegen die großen Avocado-Plantagen für den Export, die über Wasserrechte verfügen und in der Praxis den Vorrang beim Verbrauch haben. María Catalina Espinoza, Präsidentin der Unión de Agua Potable und Nachbarin von Quebrada de Castro, direkt am trockenen Einzugsgebiet des Petorca-Flusses, erklärt: „Wir sind von grünen Hügeln mit Avocadobäumen umgeben, aber wir sind trocken. Es gibt Wasser, aber die Geschäftsleute haben es“. Andererseits herrscht in der Region eine historische Megadürre, die nun schon das elfte Jahr andauert. Ariel Muñoz, Professor an der Katholischen Universität von Valparaíso und Forscher zum Klimawandel, stimmt den Bewohnern von Petorca zu. Er weist darauf hin, dass es keine Planung gibt, die dem menschlichen Verbrauch und einer umweltverträglichen Bewirtschaftung Vorrang einräumt. Dies ist eine dringende Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass derzeit siebzig Prozent der Chilenen in Gebieten mit Wasserknappheit leben. Die Hoffnungen ruhen auf dem laufenden Verfassungsprozess. „Wir sind derzeit durch das Sanitärgesetz gebunden. Das Wasser muss umverteilt werden, auch wenn das vielen nicht gefällt. Es gibt Erwartungen an die neue Verfassung“, so Muñoz abschließend.
Auf der anderen Seite der Anden, in Mendoza (Argentinien), betonen Forscher die lange Dauer dieses Phänomens. Rekonstruktion des vergangenen Klimas zeigen, dass es in den letzten sechshundertzwanzig Jahren beispiellos war. Mendoza liegt in einer halbtrockenen Umgebung und erhält Wasser aus dem Gebirge, das eine Oase bildet, die seit Jahrhunderten für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wird. Die derzeitige Dürre führt jedoch dazu, dass die Wasserverfügbarkeit abnimmt – nach Angaben der Generaldirektion für Bewässerung liegt sie dreißig Prozent unter dem historischen Wert -, während die Bevölkerung wächst und die Provinz inzwischen 1,8 Millionen Einwohner zählt. Überwachung, Gesetzgebung, Kontrolle und Management sind notwendig, um die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und die Ökosysteme zu erhalten. Und in dieser Wasserkrise mit wenig Handlungsspielraum sind die lateinamerikanischen Megastädte mit am durstigsten. Die UNO zählt Mexiko-Stadt und Sao Paulo zu den zehn größten Städten der Welt, in denen die Wasserversorgung gefährdet ist. Im Fall von Mexiko-Stadt hat jeder fünfte der 21 Millionen Einwohner nur stundenweise Leitungswasser. Der Wasserverlust aufgrund von Problemen im Rohrleitungssystem wird auf vierzig Prozent geschätzt. Nach Angaben von Experten könnte Mexiko-Stadt bis 2030 kein Wasser mehr haben. Im Fall von Sao Paulo hat eine lange Dürre dazu geführt, dass in einigen Gebieten Wasser rationiert und in Lastwagen verteilt wird. Im Jahr 2014 gab es bereits Proteste in der Stadt, weil die Wasserversorgung unterbrochen wurde.
Es gibt praktisch kein lateinamerikanisches Land, das nicht seine eigene Wasserkrise erlebt, egal ob es sich um einen territorialen Riesen oder eine kleine Nation handelt, die von Hunderten von Flüssen durchzogen wird. Zu dieser Kategorie gehört auch El Salvador, wo der Zugang zu Wasser immer unsicherer wird. Nach Angaben des Forschers Andrés McKinley, Experte für Wasser- und Bergbaufragen an der Universidad Centroamericana, haben die wichtigsten Flüsse des Landes in den letzten fünfundzwanzig Jahren im leichtesten Fall dreißig und im schwersten Fall siebzig Prozent ihrer Wassermenge verloren. „Die wichtigsten Grundwasserleiter sinken mit einer Rate von einem Meter pro Jahr und achtzig Prozent des Wassers ist kontaminiert“. Als Faktoren für diesen Wasserstress nennt McKinley die hohe Bevölkerungsdichte, die intensive Nutzung der Ressource, den Klimawandel und vor allem den Raubbau durch Unternehmen. Es besteht kein Zweifel: Die Wasserkrise ist bereits zu einem neuen Faktor der Instabilität für einen wasserreichen, aber zunehmend durstigen Kontinent geworden.





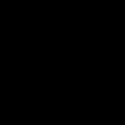






















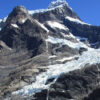










 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!