Wirtschaftswissenschaftler schätzen Lateinamerika auf seine eigene Weise. Es ist eine Fundgrube von Beispielen dafür, wie potenziell erfolgreiche Länder aufgrund schlechter Regierungsführung zu Außenseitern gemacht werden. In Venezuela eine humanitäre Katastrophe, in Argentinien Stagnation und Zahlungsunfähigkeit, in Kolumbien ein Guerillakrieg mit Drogenbaronen, in Bolivien ein Militärputsch usw. Ein vulkanisches Umfeld, das mit Wirtschaftswachstum nicht vereinbar ist.
Die Ausnahmen lassen sich an den Fingern abzählen: Es sind das kleine Uruguay mit einem entwickelten Bankensektor, die Offshore-Republik Panama und Chile – eine ganz eigene Erfolgsgeschichte. In den letzten Jahrzehnten hat dieses Land die extreme Armut beseitigt, seine Hauptstadt mit Wolkenkratzern bebaut und sich zu einem Ziel für Migranten aus dem ganzen Kontinent entwickelt. Außerdem handelt man in diesem Land auch aktiv mit Kryptowährungen, da es den Nutzern solche Plattformen wie BitiCodes zur Verfügung stehen. Doch Mitte Oktober 2019 wurden die Fans des „chilenischen Wirtschaftswunders“ bitter enttäuscht.
Die Pogrome, die die massiven Straßenproteste seit drei Monaten begleiten, haben der chilenischen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt. Besonders betroffen sind die Sektoren Handel und Tourismus. Santiagos zentrale Allee sieht aus, als hätte sie den Beschuss überlebt, und die transatlantischen Flugzeuge aus Europa starten halbleer nach Chile. Und dabei sind der Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Abfluss von ausländischem Kapital noch gar nicht berücksichtigt.
Das wichtigste Schaufenster, das die Demonstranten zerschlagen haben, ist jedoch symbolisch. Es ist ein Paradebeispiel für den Erfolg des „brutalen chilenischen Neoliberalismus“, wie die Demonstranten dieses Wirtschaftsmodell selbst nennen. Von den einen gehasst, von den anderen akzeptiert, steht dieses Modell nun auf dem Prüfstand. Sollte sich die Diagnose des Neoliberalismus bestätigen, wird der Nachhall der Krise in Chile weit über Lateinamerika hinaus zu spüren sein.
Nach Beginn der Demonstrationen am 18. Oktober schrieben vierzig Wirtschaftswissenschaftler der Katholischen Universität einen offenen Brief, in dem sie zugaben, dass sie die Krise nicht vorhersehen konnten, und dazu aufriefen, der Ungleichheit in der chilenischen Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
In gewissem Sinne haben sie immer gedacht, dass wirtschaftliche Probleme die schwierigsten in den Sozialwissenschaften sind. Aber hier sind sie mit etwas konfrontiert, das viel komplexer zu sein scheint. Jetzt müssen sie zurückblicken und herausfinden, was genau sie übersehen haben.
Vor fast einem halben Jahrhundert spielte die Katholische Universität von Chile eine Schlüsselrolle bei dem, was viele heute als „chilenisches Wirtschaftswunder“ bezeichnen. Mehr ein Marketing-Slogan als ein akademischer Begriff, entstand er in den 1970er Jahren dank angesehener westlicher Wirtschaftswissenschaftler, die die Marktreformen von General Augusto Pinochet öffentlich unterstützten.
Das Gesicht der westlichen Unterstützung für die chilenische Militärjunta war der Begründer des Monetarismus, der einflussreiche amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman. Friedman inspirierte eine Generation von „Chicago Boys“ – junge chilenische Wirtschaftswissenschaftler, die in den 60er Jahren an der Universität von Chicago die neue Marktwirtschaft studierten. Der Kalte Krieg war in vollem Gange, und die US-Regierung nutzte aktiv Bildungsprogramme, um pro-kapitalistische Ideen in Lateinamerika zu fördern.
Nach dem Militärputsch von 1973 schlugen die „Chicago Boys“, die die Niederlage der Sozialisten unterstützt hatten, Pinochet ein Wirtschaftsreformprogramm vor. Die Rezepte der jungen Technokraten waren so radikal, dass sie die chilenischen Generäle zunächst abschreckten (ebenso wie Salvador Allendes Wahlkampfgegner 1970, der das Team aus Chicago als „Verrückte“ bezeichnete). Doch der Wunsch, die alleinige Macht zu behalten, und der Kampf des Apparats mit dem Führer des konservativen Flügels der Armee, General Gustavo Li, zwangen Pinochet zu einem riskanten Experiment.
Es war in der Tat ein nicht weniger revolutionäres Projekt als der Aufbau des demokratischen Sozialismus des gerade abgesetzten Allende. Die Gründe für Pinochets anfängliches Zögern sind verständlich. Erstens sind die Militärregime in Lateinamerika in der Regel nicht anfällig für wirtschaftliche Freiheiten, sondern bevorzugen einen starken Staat, Patriotismus und Spiritualität. Zweitens stand das, was die Anhänger der freien Marktwirtschaft in Chicago vorschlugen, in krassem Gegensatz zu der damals vorherrschenden Auffassung von Wirtschaftsordnung.





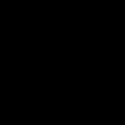

































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!