Die Welt braucht dringend Lösungen zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen, die den Klimawandel verursachen. Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselelement für Sektoren, die schwer zu dekarbonisieren sind, wie die Stahlindustrie, die Düngemittelindustrie, die chemische Industrie und Kraftstoffe für den Fernverkehr. Diese Sektoren benötigen große Mengen an Energie in chemischer Form und sind derzeit von fossilen Brennstoffen abhängig. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, einem Prozess, bei dem Strom aus erneuerbaren Quellen (wie Sonne, Wind oder Wasserkraft) verwendet wird, um das Wassermolekül in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Diese Technologie in großem Maßstab und zu niedrigen Kosten rentabel zu machen, ist noch eine Herausforderung. Brasilien verfügt über eine einzigartige Infrastruktur, um diese Industrie voranzutreiben und bei der Energiewende eine Führungsrolle zu übernehmen. Darüber hinaus festigen das Gesetz über kohlenstoffarmen Wasserstoff (vom August 2024) und seine künftigen Durchführungsbestimmungen die Position Brasiliens in diesem Bereich.
Einzigartigkeit Brasiliens
Die großtechnische Produktion von grünem Wasserstoff erfordert günstigen und reichlich vorhandenen Strom aus erneuerbaren Energien. Wie schneidet Brasilien im globalen Vergleich ab? Wenn wir uns die Atlanten für Solarenergie und Windenergie ansehen, stellen wir fest, dass Brasilien über sehr gute, aber nicht außergewöhnliche Ressourcen verfügt. Dieses Bild ändert sich, wenn wir die Stromnetze verschiedener Länder betrachten. In dieser Hinsicht ist Brasilien führend und weist den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien unter den größten Volkswirtschaften der Welt auf. In Anbetracht seiner räumlichen Ausdehnung und des Anteils erneuerbarer Energien (rund 90 %) ist das brasilianische Verbundnetz (SIN) weltweit einzigartig. Das SIN verbindet das Land von Norden nach Süden, nutzt die Komplementaritäten zwischen Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft und Biomasse und nutzt Wasserreservoirs zur Speicherung von Energie und zur Flexibilisierung des Systems. Das SIN ist das Ergebnis harter Arbeit und Erfindungsreichtums und stellt eine brasilianische Besonderheit für die Integration von grünem Wasserstoff dar.
Netzanbindung und CO2-Neutralität
Stromnetze sind dafür bekannt, Synergien zu fördern. Sie schaffen wirtschaftliche Effizienz, indem sie die Komplementaritäten zwischen mehreren Erzeugern und Verbrauchern nutzen und die Netzinfrastruktur gemeinsam nutzen. Aufgrund dieses wirtschaftlichen Vorteils schließen wir unsere Häuser, Büros und Industriebetriebe an das Netz an. Bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff ist das nicht anders. Es gibt Vorteile, ihn an das Netz anzuschließen.
Aber die Anbindung bringt auch Herausforderungen mit sich. Da dasselbe Netz auch fossile Kraftwerke verbindet, wie kann man dann sicherstellen, dass der Strom erneuerbar ist? Diese Garantie wird unter dem Begriff „Kohlenstoffintegrität“ bewertet, der sicherstellen soll, dass die Anbindung von grünem Wasserstoff keine Kohlenstoffemissionen an anderen Stellen des Stromnetzes verursacht. Induzierte Emissionen würden seine grüne Eigenschaft beeinträchtigen. Dies ist ein aktuelles Forschungsthema, und unsere Gruppe am Nationalen Zentrum für Energie- und Materialforschung (CNPEM) hat den brasilianischen Fall in einem kürzlich in der Fachzeitschrift Applied Energy veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel analysiert.
Anforderungen an die Stromversorgung
Die CO2-Neutralität wird durch Anforderungen an die Stromversorgung gewährleistet. Der Ansatz der Europäischen Union, grünen Wasserstoff durch zusätzliche Kapazitäten aus erneuerbaren Energien zu sichern, findet international zunehmend Verbreitung. Zu diesem Zweck wurde ein dreiteiliges Anforderungskonzept entwickelt:
1- Zusätzlichkeit, die sicherstellen soll, dass die elektrische Energie aus einer neuen installierten Kapazität für erneuerbare Energien stammt;
2 – Lieferbarkeit, die sicherstellen soll, dass diese zusätzliche Kapazität mit der Wasserstoffproduktion verbunden ist;
3 – Zeitliche Abstimmung, die darauf abzielt, die zusätzliche Erzeugung aus erneuerbaren Energien und deren Verbrauch bei der Wasserstoffproduktion zeitlich aufeinander abzustimmen (in der Praxis eine Abstimmung auf Stundenbasis). Durch den Einsatz vertraglicher und regulatorischer Instrumente zur Kopplung von grünem Wasserstoff an zusätzliche Kapazitäten aus erneuerbaren Energien würde somit dessen CO2-Neutralität gewährleistet.
Die international verbreitete Konzeption betont den zusätzlichen Aspekt (neue Projekte) und ignoriert die Synergien, die bereits bestehende kohlenstoffarme Infrastrukturen bieten. Der Unterschied zwischen Netzwerken wie dem brasilianischen wird in diesem Ansatz, der die Produktion von grünem Wasserstoff leitet, nicht berücksichtigt, und aus dieser Perspektive der Kohlenstoffintegrität verschwindet der brasilianische Unterschied.
Fossil, aber noch vorhanden
Wenn einerseits die strikte Betonung des Zusätzlichen unangemessen ist, ist andererseits auch das völlige Fehlen von Anforderungen problematisch. Betrachten wir zwei Szenarien. Wenn eine grüne Wasserstoffanlage zu Beginn einer windstillen Nacht in Betrieb ist, woher kommt dann die Energie? Wenn das System fossilen Strom zur Deckung des Bedarfs einspeist, ist die Kohlenstoffintegrität gefährdet. Das andere Szenario ist eine Wasserknappheit. Das System wird fossile Energie bereitstellen, um die Netzsicherheit zu gewährleisten. Kann die Wasserstoffproduktion unter diesen Umständen als 100 % grün betrachtet werden? Das brasilianische System besteht zu etwa 90 % aus erneuerbaren Energien. Unsere Risiken der Induzierung von Kohlenstoffemissionen im Netz sind im internationalen Vergleich sehr gering. Allerdings sind diese Risiken, auch wenn sie geringer sind, dennoch vorhanden. Die Kohlenstoffintegrität muss in den Diskussionen über grünen Wasserstoff in Brasilien berücksichtigt werden. Wir brauchen eine Konzeptualisierung der Kohlenstoffintegrität, die unseren Gegebenheiten angemessen ist.
Es gibt noch viel zu tun
Die Kohlenstoffintegrität, die auf den Anforderungen der Zusätzlichkeit, Lieferbarkeit und Gleichzeitigkeit basiert, hat Einschränkungen, die durch die Forschung aufgezeigt wurden. Daher gibt es Raum für alternative Ansätze, insbesondere für Netze wie das brasilianische, die bereits fortgeschrittene Stadien der Dekarbonisierung erreicht haben. Eine alternative Konstruktion der Anforderungen müsste Folgendes berücksichtigen:
1- Klarheit, um zur Entwicklung der grünen Wasserstoffindustrie beizutragen;
2 – Wirksamkeit bei der Gewährleistung der Kohlenstoffintegrität;
3 – Aufwertung der bereits vorhandenen kohlenstoffarmen Infrastruktur;
4 – Anwendbarkeit und internationale Anerkennung.
Wenn Brasilien seine Vision von Kohlenstoffintegrität formalisiert, wird es die Voraussetzungen haben, um in dieser Diskussion eine führende Rolle zu spielen. Wenn es sich hingegen dafür entscheidet, das Thema zu ignorieren, wird es von importierten Konzepten abhängig bleiben und riskiert, seinen Vorsprung zu verspielen.


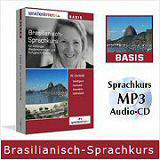






































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!