Der in Costa Rica ansässige Internationale Gerichtshof (IGH) hat am Mittwoch (23.) in einem Gutachten zu den rechtlichen Verpflichtungen und der wirtschaftlichen Verantwortung der Staaten erklärt, dass der Klimawandel eine „dringende und existenzielle Bedrohung” darstellt. Die Entscheidung des IGH gilt als historisch, da das Gutachten die weltweite Rechtsprechung beeinflussen könnte: Viele Experten glauben, dass die Meinung der Richter einen Wendepunkt in Klimaprozessen weltweit markieren könnte. Schätzungen zufolge gibt es mehr als 3.000 Klagen in über 60 Ländern. Der IGH ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen (UN). Er ist auch als Internationaler Gerichtshof oder Weltgericht bekannt.
„Die negativen Auswirkungen des Klimawandels können die wirksame Ausübung bestimmter Menschenrechte, wie das Recht auf Gesundheit und das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, erheblich beeinträchtigen“, sagte der Präsident des IGH, Yuji Iwasawa, bei der Verlesung des Gutachtens, das von den 15 internationalen Richtern des Gerichts verfasst wurde. Experten erklärten, dass die Meinung der Richter die Klimagerechtigkeit neu gestalten und große Auswirkungen auf die Gesetze weltweit haben könnte. „Das Gericht stellt fest, dass die Folgen des Klimawandels schwerwiegend und weitreichend sind: Sie betreffen sowohl natürliche Ökosysteme als auch die menschliche Bevölkerung. Diese Folgen unterstreichen die dringende und existenzielle Bedrohung, die vom Klimawandel ausgeht”, sagte Richter Yuji Iwasawa.
Referenz im Völkerrecht
Analysten weisen darauf hin, dass diese Entscheidung die wichtigste in einer Reihe von jüngsten Entscheidungen zum Klimawandel im Völkerrecht ist, da Gerichte zunehmend zu einem Schlachtfeld für Klimaklagen werden. Nach Ansicht des IGH stellt die „Verletzung“ der Klimaverpflichtungen durch einen Staat „eine völkerrechtswidrige Handlung“ dar, die unter bestimmten Voraussetzungen und im Einzelfall zu Entschädigungszahlungen an die betroffenen Länder führen kann, so das Gericht. „Die rechtlichen Folgen einer völkerrechtswidrigen Handlung können (…) den vollständigen Ersatz des Schadens der geschädigten Staaten in Form von Rückerstattung, Entschädigung und Genugtuung umfassen”, erklärte der Präsident des Gerichtshofs, Yuji Iwasawa. Obwohl nicht bindend, wird die Entscheidung der 15 Richter des IGH in Den Haag juristisches und politisches Gewicht haben, und künftige Klimaprozesse werden sie nicht ignorieren können.
„Sie ist so wichtig, dass sie aufgrund der Tragweite der darin behandelten Fragen, die den Kern der Klimagerechtigkeit betreffen, eine der relevantesten rechtlichen Entscheidungen unserer Zeit sein könnte“, so Joie Chowdhury, Senioranwältin beim International Center for Environmental Justice. Die beiden Fragen, die die UN-Generalversammlung den Richtern vorgelegt hat, lauteten: Welche Verpflichtungen haben die Länder nach dem Völkerrecht, das Klima vor Treibhausgasemissionen zu schützen? Welche rechtlichen Konsequenzen haben für Länder, die das Klimasystem schädigen? „In Bezug auf die Verpflichtung, erhebliche Umweltschäden zu verhindern, ist das Gericht der Ansicht, dass diese auch für das Klimasystem gilt, das ein integraler und wesentlicher Bestandteil der Umwelt ist und für heutige und künftige Generationen geschützt werden muss“, erklärte Richter Iwasawa.
Der Richter fügte hinzu, dass „die negativen Auswirkungen des Klimawandels die wirksame Ausübung bestimmter Menschenrechte, wie das Recht auf Gesundheit“ und „das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard“, erheblich beeinträchtigen können. In zweiwöchigen Anhörungen vor dem IGH im Dezember 2024 erklärten die reichen Länder des Globalen Nordens den Richtern, dass bestehende Klimaverträge, darunter das weitgehend unverbindliche Pariser Abkommen von 2015, die Grundlage für die Festlegung ihrer Verantwortlichkeiten bilden sollten. Entwicklungsländer und kleine Inselstaaten forderten jedoch strengere, in einigen Fällen rechtlich bindende Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen und zur Bereitstellung finanzieller Hilfe durch die größten Emittenten von Treibhausgasen, die die globale Erwärmung verursachen.
Pariser Abkommen
2015 verpflichteten sich mehr als 190 Länder zum Abschluss der UN-Verhandlungen in Paris, ihre Anstrengungen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C fortzusetzen. Das Abkommen konnte den Anstieg der globalen Treibhausgasemissionen nicht eindämmen. Ende letzten Jahres erklärte die UNO in ihrem jüngsten „Emissions Gap Report“, der eine Bilanz der Versprechen der Länder zur Bekämpfung des Klimawandels im Vergleich zu den erforderlichen Maßnahmen zieht, dass die derzeitige Klimapolitik bis 2100 zu einer globalen Erwärmung von mehr als 3 °C über dem vorindustriellen Niveau führen wird. Da Aktivisten versuchen, Unternehmen und Regierungen zur Verantwortung zu ziehen, haben klimarelevante Rechtsstreitigkeiten zugenommen. Laut Daten des Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment in London wurden im Juni fast 3.000 Fälle in fast 60 Ländern registriert.
Bislang waren die Ergebnisse dieser Verfahren gemischt. So wies beispielsweise ein deutsches Gericht im Mai eine Klage eines peruanischen Landwirts gegen den deutschen Energiekonzern RWE ab, doch dessen Anwälte und Umweltschützer bezeichneten den Fall, der sich über ein Jahrzehnt hingezogen hatte, dennoch als Sieg für Klimaklagen, die ähnliche Verfahren nach sich ziehen könnten.


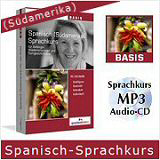








































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!