Gold fließt aus dem Amazonas wie ein Versprechen – doch hinter seinem Glanz verbirgt sich ein langsam wirkendes Gift. Quecksilber, das heimlich gehandelt und unter freiem Himmel zum Einsatz kommt, verseucht Flüsse, schürt Gewalt und hinterlässt ganze indigene Gemeinschaften, die den Preis in Form von geschädigten Seelen zahlen müssen. Es beginnt mit einem Schimmern. Ein Bergmann steht knietief in einem abgelegenen Fluss im Amazonasgebiet und schüttet Quecksilber in eine Plastikschüssel mit Sedimenten. Das Quecksilber haftet wie ein Magnet am Gold. Die beiden verschmelzen zu einem Klumpen, der vor Gewinn – und Gefahr – glänzt. Der nächste Schritt ist einfach und verheerend: Verbrennen. Das Quecksilber verdampft in die Luft und trägt neurotoxische Dämpfe in die Lungen aller Menschen in der Nähe. Zurück bleiben Gold – und ein unsichtbarer Nebel, der sich in Boden, Wasser und Körpern absetzt. Dort wird er zu Methylquecksilber, einer Verbindung, die über die Nahrungskette aufsteigt und über Fisch, Wild und sogar Muttermilch in den menschlichen Organismus gelangt.
Laut „The Associated Press“ werden durch diesen illegalen Kleinbergbau jedes Jahr fast 800 Tonnen Quecksilber in das Amazonasbecken freigesetzt. Das reicht aus, um ganze Flusssysteme für Generationen zu verseuchen. Quecksilber wird nie abgebaut. Es wandert einfach weiter – von der Hand in die Flamme, in den Fluss und in den Fötus. Und dennoch geht der Handel weiter, legalisiert durch Gesetzeslücken und begünstigt durch Armut. Wenn man mit einem Tag Baggerarbeit ein Gramm Gold gewinnen kann, das mehr wert ist als die monatlichen Lebensmittelkosten einer Familie, ist es schwer, Nein zu sagen. Aber auf der Jagd nach diesem Glanz wird der Amazonas langsam und still vergiftet.
Kartelle profitieren vom Quecksilberhandel
Gold hat schon immer Kriminelle angezogen, aber der Quecksilberhandel schafft einen neuen Schwarzmarkt, der genauso gefährlich ist wie der Drogenhandel, mit dem er oft Hand in Hand geht. In einem umfassenden Bericht vom Juli beschrieb die Environmental Investigation Agency (EIA) eine zunehmende Überschneidung zwischen Quecksilberhandel, Drogenkartellen und illegalem Goldabbau. Zwischen April 2019 und Juni 2025 verfolgten Ermittler mindestens 180 Tonnen Quecksilber, die von Mexiko nach Kolumbien, Bolivien und Peru transportiert wurden. Die Schmuggelrouten ähneln den Kokainkorridoren: isoliert, gewalttätig und durch Korruption geschützt. Die Environmental Investigation Agency ist eine gemeinnützige Organisation, die 1984 von den drei Umweltaktivisten Dave Currey, Jennifer Lonsdale und Allan Thornton in England gegründet wurde.
Erst letzten Monat öffneten peruanische Zollbeamte scheinbar gewöhnliche Säcke mit Kies – und entdeckten vier Tonnen mexikanisches Quecksilber, die größte Beschlagnahmung in der Geschichte Südamerikas. Forensische Analysen führten das Metall zu unregulierten Öfen in mexikanischen Bergbaugebieten zurück, die mittlerweile vom Sinaloa-Kartell kontrolliert werden, das angesichts der weltweit sinkenden Nachfrage nach Kokain und steigender Goldpreise sein Geschäftsfeld auf Quecksilber ausgeweitet hat. The Guardian bestätigte die Beteiligung des Sinaloa-Kartells und berichtete, dass die Schmuggler nun Kokablätter verwenden, um Fässer mit Quecksilber zu tarnen, die unter dem Schutz der Nacht auf Lastwagen nach Bolivien transportiert werden. Morde im Zusammenhang mit Quecksilberbeschlagnahmungen sind mittlerweile Teil der regionalen Polizeiprotokolle – ein düsteres Zeichen dafür, wie wertvoll das flüssige Metall geworden ist.
Indigene Gemeinschaften tragen die Hauptlast
Wo Gold glänzt, ist Blut nie weit. Während die Schmuggler profitieren, zahlen die indigenen Gemeinschaften des Amazonasgebiets stillschweigend. Im peruanischen Departement Madre de Dios, das oft als Epizentrum des illegalen Bergbaus bezeichnet wird, haben die Quecksilberwerte beim Menschen alarmierende Höhen erreicht. Laut dem englischsprachigen Online-Magazin Mongabay wurde Methylquecksilber in Muttermilch, Flusswasser und wichtigen Fischarten gefunden. In Brasilien weisen Haarproben von Kindern aus Flussdörfern Quecksilberwerte auf, die weit über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation liegen. Das Gift schädigt das Gehirn, insbesondere das noch in der Entwicklung befindliche. Es verursacht Zittern, Gedächtnisverlust, Lernverzögerungen und mit der Zeit irreversible Schäden am Nervensystem. Da die Symptome jedoch allmählich auftreten, ist die Krise schwer zu filmen und leicht zu ignorieren. Es gibt keine spektakulären Bilder, keine viralen Drohnenaufnahmen – nur Kinder, die sich nicht konzentrieren können, und ältere Menschen, deren Hände zittern.
In einem Flussdorf tauchte ein Gesundheitshelfer mit einem tragbaren Quecksilberanalysator auf und forderte die Familien auf, auf den Verzehr von Wels und Schildkrötenfleisch zu verzichten. „Wir ändern unsere Kultur, um zu überleben“, sagte ein Anführer der Asháninka gegenüber EFE – ein leiser Satz, der Bände spricht. Quecksilber verändert Traditionen, die seit Jahrhunderten bestehen. Das Fischen ist kein Übergangsritus mehr, sondern ein Glücksspiel mit geringen Gewinnchancen und unsichtbaren Risiken.
Lücken, Verträge und ein Kampf gegen die Zeit
Das Minamata-Quecksilberübereinkommen von 2013, das von 128 Ländern unterzeichnet wurde, sollte dieser Krise ein Ende setzen. Es sah vor, Quecksilber im Kleinbergbau bis 2032 schrittweise abzuschaffen, doch Ausnahmeregelungen und mangelnde Durchsetzung haben es zu wenig mehr als einem Versprechen gemacht. Theoretisch haben Peru und Brasilien 2016 Quecksilberimporte verboten. In der Praxis ist Quecksilber jedoch immer noch leichter zu bekommen als Bücher oder Antibiotika, so der bolivianische Umweltaktivist Óscar Campanini gegenüber EFE. Schmuggler fälschen Rechnungen, kennzeichnen Container falsch und verstecken Lieferungen unter diplomatischen Zollcodes für Industriegüter. Auf der Konferenz der Vertragsparteien des Minamata-Übereinkommens im November werden Diplomaten versuchen, diese Lücken zu schließen. Zu den Vorschlägen gehören die Verpflichtung der Exportländer zur Überprüfung der Endverbraucher, die Abschaffung von Ausnahmen für den Bergbau und die Ausweitung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Durchsetzung. Allerdings sind Verträge nur so stark wie ihre Durchsetzung. Flusspatrouillen sind rar und Schmuggler sind zahlreich.
Befürworter sagen, die einzige wirkliche Lösung bestehe darin, Quecksilber zu verdrängen – durch Investitionen in schwerkraftbasierte Verarbeitungsanlagen, Fair-Trade-Prämien für quecksilberfreies Gold und die Vergabe legaler Bergbaurechte an Betreiber, die sich zu sichereren Methoden verpflichten. Einige Pilotprojekte sind vielversprechend, aber die Finanzierung bleibt begrenzt und der politische Wille ist uneinheitlich. Die Uhr tickt. Jeder neue Anstieg des Goldpreises hallt in diesem verborgenen Kriegsgebiet wider. Die London Metals Exchange mag den Preis festlegen, aber es sind die indigenen Mütter in Bolivien und die barfüßigen Bergleute in Peru, die die Kosten tragen. In diesen Tälern vergiftet Quecksilber nicht nur die Umwelt – es überlebt auch alle. Es sickert in die Flussbetten, gelangt in zukünftige Schwangerschaften und bleibt in Fischen zurück, die in einer Generation gefangen werden.
Während die Welt auf grüne Technologien und goldgedeckte Finanzierungen drängt, muss sie sich fragen: Ist der Preis eines Eherings das geschädigte Gehirn eines Kindes wert? Ist ein Stück illegaler Goldbarren die Zerstörung eines ganzen Ökosystems wert?


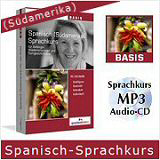




































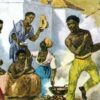


 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!