Über Jahrhunderte hinweg war die Sozialhilfe in Brasilien eng mit der christlichen Religion verflochten. Die traditionell mit der katholischen Kirche verbundene Praxis der Nächstenliebe prägte seit der Kolonialzeit das Sozialwesen. Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann dieses Modell jedoch, eine stärker politische, institutionelle und später auch professionalisierte Ausrichtung anzunehmen. Dieser Prozess, der als Säkularisierung der Sozialhilfe bekannt ist, stellte keinen einfachen Bruch mit der religiösen Vergangenheit dar, sondern eine langsame und komplexe historische Transformation, die von ideologischen Auseinandersetzungen, institutionellen Veränderungen und unterschiedlichen Allianzen zwischen Staat, Kirche und Zivilgesellschaft geprägt war.
Der Einfluss der Kirche und die Entstehung einer Sozialpolitik
Die historische Entwicklung der Sozialhilfe in Brasilien hat ihre Wurzeln tief im Katholizismus. Krankenhäuser, Altenheime und Santas Casas, die fast immer von religiösen Orden verwaltet wurden, spielten jahrhundertelang eine wesentliche Rolle bei der Versorgung der Armen und Kranken. Nach einer Phase starken Einflusses der Action Française, einer konservativ inspirierten katholischen Bewegung, näherten sich Teile der Kirche in Brasilien dem Marxismus an, was schließlich zur Entstehung der Befreiungstheologie führte. Um die Wende der 1960er Jahre erweiterte diese neue Strömung den Umfang der pastoralen Arbeit und rückte soziale Kämpfe in den Vordergrund. In den folgenden Jahrzehnten ermöglichten Partnerschaften mit sozialen Bewegungen die Verknüpfung von Hilfe mit Forderungen nach Rechten und festigten so den Übergang von der Wohltätigkeit zur Staatsbürgerschaft.
So durchlief die Sozialhilfe einen gewundenen Weg der Säkularisierung, der nicht nur den Übergang von religiösen zu staatlichen Akteuren mit sich brachte, sondern auch den Aufbau eines autonomen Feldes sozialer Aktion außerhalb der Kontrolle der Kirche und teilweise auch der ideologischen Politik. Der moralische Wert der christlichen Nächstenliebe wich einem politischen und später einem technischen und bürokratischen Ideal. Dieser symbolische und institutionelle Übergang von der Nächstenliebe zur Politik und von dieser zur Professionalität bereitete den Boden für das Entstehen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich in den 1980er Jahren als neue soziale Akteure etablieren sollten.
Das Aufkommen der NGOs und der neue Aktivismus
Der Begriff „Nichtregierungsorganisation” kam 1986 in Brasilien auf, während des Nationalen Treffens der brasilianischen Förderzentren, als über die Schaffung einer institutionellen Identität für diese neue Art von Organisation diskutiert wurde. Der Ausdruck war auf internationaler Ebene bereits seit 1945 bekannt, als er in Dokumenten des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen auftauchte. Die Mehrdeutigkeit des Begriffs NGO – private, gemeinnützige Einrichtungen, die im öffentlichen Interesse tätig sind – ermöglichte die Selbstidentifizierung von Organisationen mit unterschiedlichen Motivationen, aber konvergenten Zielen. So entstand ein neuer Akteur im Bereich der Sozialpolitik: weder staatlich noch religiös, aber zutiefst einflussreich. Es ist erwähnenswert, dass viele der NGOs, die diesen Professionalisierungsprozess im Sozialbereich anführten, aus Erfahrungen im Zusammenhang mit der Kirche hervorgegangen sind. Ein symbolträchtiges Beispiel ist die Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE, Verband für Sozial- und Bildungshilfe), die 1961 auf Initiative von William Brown, einem katholischen Ingenieur, und Edmund Leising, einem in Brasilien lebenden amerikanischen Priester, gegründet wurde.
Eine weitere wichtige Organisation, die als „Vorbild” für diesen noch jungen institutionellen Bereich fungierte, war das Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), das 1981 auf Initiative von drei Aktivisten gegründet wurde, die während der Diktatur im Exil gelebt hatten und nach der Amnestie nach Brasilien zurückkehrten: Herbert de Souza, genannt Betinho, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, sowie Carlos Afonso und Marcos Arruda. 1993 wurde Betinho durch die Kampagne Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida (Bürgeraktion gegen Hunger, Elend und für das Leben) bekannt, die das Land mobilisierte, um mehr als 32 Millionen Brasilianern zu helfen, die laut damaligen Angaben des Ipea unterhalb der Armutsgrenze lebten.
Nach den 1990er Jahren erlebte Brasilien das Wachstum eines weniger ideologischen und eher effizienzorientierten Aktivismusmodells. Dieses Modell wurde von vielen NGOs vorangetrieben, die eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft übernahmen. Die NGOs institutionalisierten und professionalisierten sich: Sie formalisierten ihre rechtliche Struktur, spezialisierten ihre Teams und diversifizierten ihre Finanzierungsquellen. Viele von ihnen gingen Partnerschaften mit internationalen Agenturen ein, während andere sich dem privaten Sektor annäherten und ihren Tätigkeitsbereich erweiterten. Laut Ibase waren die 1990er Jahre geprägt von einer Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit und einem deutlichen Wachstum dieser NGOs, die sich auf soziale Projekte in Bereichen wie Umwelt, Gesundheit, Bildung und Menschenrechte konzentrierten.
Der jüngste Rückschritt und die Herausforderungen für die Säkularisierung
In den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts beobachten wir weltweit einen Aufstieg rechtsextremer Regierungen, auch in Brasilien. Diese Bewegungen haben neue Herausforderungen für die Säkularisierung der Sozialhilfe mit sich gebracht. Die Rückkehr religiöser Diskurse als Kriterium für die Festlegung öffentlicher Politik, die Infragestellung der Wissenschaft und die Angriffe auf NGOs deuten auf den Versuch hin, die Öffentlichkeit auf der Grundlage konservativer moralischer Werte wieder zu verzaubern. Die Arbeit von Organisationen der Zivilgesellschaft in den Bereichen Menschenrechte, Umwelt und Armutsbekämpfung ist zum Ziel von Verdächtigungen und Delegitimierungskampagnen geworden. In vielen Fällen werden diese Organisationen ohne Beweise der ideologischen Einmischung oder der Förderung einer „globalistischen Agenda” in einem zunehmend polarisierten Umfeld beschuldigt.
Eine Geschichte in Bewegung
Die Säkularisierung der Sozialhilfe in Brasilien ist weder ein linearer noch ein unumkehrbarer Prozess. Es handelt sich um einen langen Wandel, der Rückschlägen und Fortschritten unterworfen ist und die politischen und symbolischen Auseinandersetzungen um die Rolle des Staates, der Religion und der Zivilgesellschaft beim Schutz der Schwächsten widerspiegelt. Es ist jedoch zu beobachten, dass das Aufkommen von NGOs als zentrale Akteure in der brasilianischen Sozialpolitik, obwohl es von Ambivalenzen und Widersprüchen geprägt ist, den Höhepunkt eines Prozesses darstellt, der innerhalb der Kirche begann, sich aber außerhalb von ihr mit neuen Werten, neuen Institutionen und neuen Handlungsformen weiterentwickelte. Die Zukunft der säkularen Sozialhilfe wird in hohem Maße von der Fähigkeit der Gesellschaft abhängen, die Autonomie dieses Bereichs gegenüber den moralischen, politischen und wirtschaftlichen Zwängen, die ihn bedrohen, zu bewahren.


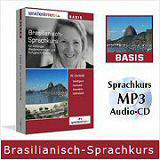








































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!