Perus Amazonasgebiet trägt Narben, die im kollektiven Gedächtnis der Nation weitgehend unsichtbar bleiben. Der neue Dokumentarfilm „Shiringa“ unter der Regie von Wilton Martínez konfrontiert das Publikum mit dem blutigen Erbe der Kautschukgewinnung und dem Völkermord an den indigenen Völkern und fordert eine längst überfällige Anerkennung. 2015 veröffentlichte Martínez seinen ersten Film, der die Gräueltaten des Kautschukbooms in Putumayo dokumentierte. Ein Jahrzehnt später kehrt er mit Shiringa zurück – dem indigenen Wort für Kautschukbaum –, weil, wie er erklärte, „99% der Peruaner diese Geschichte nicht kennen“. Der Film erzählt von der industriellen Grausamkeit von Julio César Arana, einem Geschäftsmann, der Politiker wurde und sein Vermögen mit Zwangsarbeit, Folter und der Ausrottung indigener Völker entlang der Grenze zwischen Peru, Kolumbien und Ecuador aufgebaut hat. Der Putumayo-Fluss, eine Grenze mit sich verschiebenden Grenzen und ungezügelter Gier, wurde zu einem Ort der Massenausbeutung.
Martínez präsentierte „Shiringa“ erstmals im Lugar de la Memoria (LUM) in Lima, dem Museum, das sich der gewalttätigen Vergangenheit Perus widmet. Dort betonte er, dass „schmerzhafte Erinnerungen in Erinnerung bleiben, gewürdigt, gefeiert und historisiert werden müssen – aber vor allem geheilt werden müssen“. Der Film will nicht nur schockieren, sondern auch Raum für Dialog, Anerkennung und schließlich Heilung einer jahrhundertealten Wunde schaffen.
Ein Völkermord, versteckt hinter Reichtum und Villen
Der Reichtum von Iquitos, heute Perus größter Stadt im Amazonasgebiet, ist untrennbar mit dem Blut der Kautschukära verbunden. Martínez erinnerte das Publikum daran, dass die prunkvollen Villen und portugiesischen Kacheln auf „dem Blut von rund 30.000 Indigenen“ erbaut wurden. Ausländische Beobachter dokumentierten die Brutalität detailliert. Der irische Konsul Roger Casement, der Gräueltaten im Kongo aufgedeckt hatte, schrieb, dass das, was er in Putumayo gesehen habe, noch schlimmer gewesen sei: Menschen wurden lebendig verbrannt, enthauptet, zu Tode geprügelt, wie Tiere gejagt und sogar als Zielscheiben für Schießübungen benutzt. Martínez erinnerte an Casements Aussage und wies darauf hin, wie sehr sie einen Mann schockierte, der durch jahrelange koloniale Ermittlungen bereits abgestumpft war.

Dies war kein Einzelfall, sondern Teil einer internationalen Kette von Mittäterschaft. Britische Unternehmen, US-Investoren, Zwischenhändler aus Barbados – alle profitierten davon. Der peruanische Staat schaute weg. Arana selbst entging der Justiz und wurde sogar Mitglied des Kongresses. Journalisten und Richter, die hätten sprechen können, schwiegen und verankerten so die Straflosigkeit tief in der politischen Kultur Perus.
Die Stimmen der Indigenen, die ihre Erinnerung zurückfordern
„Shiringa“ gibt indigenen Gemeinschaften, insbesondere den Völkern der Bora und Murui, eine Stimme. Der Künstler Brus Rubio erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur EFE, dass mindestens vier große Gruppen entlang des Putumayo dezimiert wurden. „Die Folge war der Verlust vieler weiser Menschen, der Verlust der Erinnerung, der Verlust unserer traditionellen Organisationsformen“, sagte er. Rubio beschrieb, wie seine Vorfahren mit Macheten, Zucker und Kleidung angelockt wurden, bevor sie versklavt und zur Latexernte gezwungen wurden. Für ihn ist die Mitschuld des peruanischen Staates unbestreitbar. „Es hat 100 Jahre gedauert, bis wir überhaupt darüber sprechen konnten. Das ist Mitschuld, tausendfache Mitschuld“, erklärte er und erinnerte die Zuschauer daran, dass Iquitos selbst auf dem Leid seiner Großeltern erbaut wurde. Rubio wies auf die Heuchelei einer Nation hin, die eine mit „Murui-Bora-Blut“ befleckte Flagge feiert, während sie den indigenen Völkern Gerechtigkeit und politische Macht verweigert. Diese Doppelzüngigkeit, so argumentierte er, mache sein Volk zu Bürgern nur dem Namen nach, in der Praxis jedoch zum Schweigen gebracht.
Der Film enthält auch die Stimme von Sheyla de Loayza, der Enkelin eines Mitarbeiters von Arana, die veranschaulicht, wie sich das Erbe der Komplizenschaft und des Opferdaseins über Generationen hinweg verflechten. Erinnerung, so Shiringa, ist keine einfache Trennung zwischen Bösewichten und Opfern, sondern ein vielschichtiges Erbe, mit dem die Gemeinschaften noch immer zu kämpfen haben.
Warum Shiringa jetzt wichtig ist
Peru sieht sich heute mit mehreren Krisen konfrontiert: politischer Instabilität, Umweltzerstörung und systemischem Rassismus gegenüber indigenen Völkern. In diesem Zusammenhang ist Martínez‘ Dokumentarfilm mehr als ein historisches Zeugnis – er ist eine Herausforderung für die nationale Identität. Was bedeutet es für ein Land, einen Völkermord in seinem eigenen Amazonasgebiet zu ignorieren? Der Film wurde für den Special Grifone Prize beim Nebrodi DOC International Festival in Italien nominiert und mit Unterstützung des peruanischen Kulturministeriums produziert. Nach seiner Premiere in Iquitos wird er in Lima, Pucallpa und amazonischen Städten gezeigt, in denen Erinnerung und Überleben miteinander verflochten sind. Martínez betont, dass das Ziel darin besteht, durch Kunst und Zeugnisse „die Erinnerung zu heilen”, aber auch die Privilegien eines Peru anzusprechen, das immer noch seine indigenen Wurzeln ignoriert.
Die Missbräuche des Kautschukbooms erinnern uns daran, dass die Moderne in Peru mit Blut finanziert wurde. Die opulenten Häuser von Iquitos sind architektonische Grabsteine – Denkmäler für Vermögen, die auf Sklaverei und Ausrottung aufgebaut sind. „Shiringa“ klagt nicht nur die Vergangenheit an, sondern auch die Gegenwart: Warum wird dieser Völkermord in Schulbüchern immer noch verschwiegen? Warum müssen indigene Gemeinschaften immer noch laut schreien, um gehört zu werden? Martínez‘ Botschaft ist unverblümt: Erinnerung ohne Heilung führt zu Ressentiments und Verzerrungen. Der Amazonas kann nicht vorankommen, solange die Geister der Kautschukbarone noch immer seine Flüsse heimsuchen. Der Völkermord an 30.000 Menschen ist keine historische Fußnote – er ist ein grundlegendes Trauma, das die Beziehung zwischen Staat und Wald, zwischen Lima und dem Amazonas, zwischen indigenen Völkern und einer Nation prägt, die sie allzu oft unsichtbar gemacht hat. Solange Peru dies nicht akzeptiert, wird der Reichtum von Iquitos wie die von Arana erbauten Villen glänzen – schöne Fassaden, die das Schweigen der Ermordeten verschleiern. Shiringa fordert die Nation auf, dieses Schweigen endlich zu brechen.


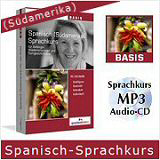






































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!