Rio de Janeiro, 2025. Auf den Knien vor ihrem toten Sohn befiehlt eine schwarze Mutter: „Nehmt das Laken weg“. Sie fordert die Welt auf, sich dem größten Massaker in der Geschichte Brasiliens in den Slums Alemão und Penha zu stellen. Mississippi, 1995. Mamie Till-Mobley begräbt ihren 14-jährigen Sohn Emmett Till, der von zwei weißen Männern gelyncht und entstellt wurde. Mamie bestand auf einem offenen Sarg. „Lasst die Welt sehen, was sie meinem Sohn angetan haben“, sagte sie. Eine unsichtbare Linie verbindet diese beiden schwarzen Mütter, die sieben Jahrzehnte und ein Kontinent trennen. In dieser Zeitspanne hallt eine Frage nach: Was kommt nach dem Blick der Welt? Am 29. Oktober 2025 erwachte Brasilien mit den brutalen Bildern des größten staatlich geförderten Massakers seiner Geschichte in den Slums Complexo do Alemão und Penha, bei dem mehr als 120 Menschen getötet wurden. Fotos und Videos von Dutzenden von Leichen – überwiegend Schwarze, alle arm – überschwemmten die sozialen Netzwerke und Medien. Ein Teil der Gesellschaft reagierte auf die Bilder des Massakers mit Jubel. „Ich habe die Fotos der Leichen, falls jemand sie sehen möchte“, kommentierte eine Leserin auf dem Instagram-Profil des Portals Metrópoles. Ein anderer antwortete: „Ich habe die Bilder gesehen und es war so befriedigend.“
Die Verbreitung von Bildern von Brutalität kann die weiße Vorherrschaft verstärken
Seit Jahrzehnten, mit der Popularisierung der visuellen Massenmedien, wird die Idee untersucht, dass die Dokumentation rassistischer Brutalität ein Schutzschild sei, ein unbestreitbarer Beweis in der Argumentation für Gleichberechtigung. Es gibt Menschen, die argumentieren, dass die Darstellung von Gewalt Gerechtigkeit fördern kann. Andererseits zeigen Untersuchungen, dass die massenhafte Verbreitung von Bildern rassistischer Brutalität, von Sklaverei bis hin zu Lynchmorden, das Leiden banalisiert, normalisiert und damit die Strukturen der weißen Vorherrschaft verstärkt. Das Vorhandensein eines expliziten Bildes von Gewalt allein garantiert nicht, dass die Medien das Opfer humanisieren. Oft sieht man das Gegenteil: Narrative, die Rassismus verstärken, um Brutalität zu rechtfertigen.
Die hegemoniale Medienlandschaft fungiert als Brücke, die Schwarzsein mit Kriminalität assoziiert und so ein Repräsentationssystem schafft und aufrechterhält, das die Sichtweise der Gesellschaft auf schwarze Menschen beeinflusst. Die übermäßige Darstellung von Schwarzen als gewalttätig erzeugt „negative Emotionen”gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe und schwächt beispielsweise die Unterstützung für Proteste für Rassengleichheit.
Gewalt gegen Schwarze als Spektakel
Seit ihrer Gründung behandelt die hegemoniale brasilianische Presse Gewalt gegen Schwarze als Spektakel, wie die Doktorarbeit „Von der Kontrolle zur Befreiung: eine Genealogie der Bilder rassistischer Gewalt in den brasilianischen Medien” zeigt. Die Studie blickte in die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen. Im 19. Jahrhundert wurden Schwarze in den Medien fast ausschließlich im Kontext der Sklaverei dargestellt, wobei ihre Kulturen und ihre Menschlichkeit ausgeblendet wurden. Im Jahr 1866 bezeichnete die Semana Ilustrada, eine der ersten Bildpublikationen des Landes, eine Lynchjustiz bereits als „Spektakel”, das auf einem öffentlichen Platz stattfand und dessen Publikum durch die Brutalität unterhalten wurde.
Jahre später, im Jahr 1876, zeigte die Revista Illustrada, eine der wichtigsten Zeitschriften jener Zeit, die Zeichnung zweier schwarzer Männer, die leblos an Pfählen hingen, eine klare Anspielung auf eine Lynchjustiz. In dieser Darstellung dient der Terror dem Zweck der Unterhaltung. Die beiläufige Platzierung der Szene neben humoristischen Cartoons normalisierte rassistische Gewalt. Das Fehlen von Kontext oder Kritik an den Morden präsentierte die Anti-Schwarze Haltung als eine Geschichte des Terrors, die Brasilien innewohnt. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entstanden Polizeimagazine wie Vida Policial und Archivo Vermelho, die nach und nach Illustrationen durch Fotos ersetzten und realistischere Darstellungen von Gewalt gegen Schwarze als Unterhaltung vermarkteten. Diese Publikationen stellten schwarze Männer als „kriminelle Feinde”, „bestialisch” und „zum Verbrechen geboren” dar. Sie zeigten ihre leblosen Körper wie seelenlose Trophäen, in einer klaren Praxis der Überwachung und Bestrafung. In der vierten Ausgabe der Zeitschrift Vida Policial aus dem Jahr 1925 heißt es: „Die Fotos werden gedruckt, damit sich die Bevölkerung immer an sie [die Kriminellen] erinnert”. Die Begründung begleitet einen Artikel, der die Verhaftung von 21 Männern, überwiegend Schwarze, beschreibt, die des Diebstahls beschuldigt werden. Der Text beschreibt sie in entmenschlichender Weise: „Es sind Diebe, die mit größter Selbstverständlichkeit und Zynismus in Familienhäuser einbrechen und alles stehlen, was sie können.”
Das Magazin überträgt die Strafgewalt von den Behörden auf die Zivilbevölkerung und argumentiert: „Egal wie effektiv die Polizei ist, jede Familie muss ihre eigenen Vorsichtsmaßnahmen treffen, sich selbst überwachen, wachsam bleiben und sich vor Kriminellen schützen.“ Der Artikel listet ausdrücklich die Namen der Verdächtigen auf, darunter auch Pseudonyme mit rassistischer Konnotation wie „Luiz Sujo“ (der Schmutzige), ein in Brasilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitetes herabwürdigendes Stereotyp.
Fernsehprogramme verbinden seit langem Schwarzsein mit Kriminalität
Wenn man diesen historischen Faden weiterverfolgt, gelangt man zu Polizeiserien des 21. Jahrhunderts wie „Brasil Urgente“ von José Luiz Datena, der davon besessen ist, Schwarzsein mit Kriminalität in Verbindung zu bringen. Der Forscher Francisco Rüdiger analysiert, wie Polizeinachrichten zur Normalisierung rassistischer Gewalt in Brasilien beigetragen haben, insbesondere nach dem Aufkommen dieser Fernsehsendungen. Er beschreibt sie als einen „Trauermarsch“, der die Brasilianer abstumpft. Die Traurigkeit, das Unbehagen und die Resignation der Gesellschaft angesichts der Absurdität staatlicher Gewalt sind in der Polizeijournalistik fest verankert. Eine Vielzahl von Studien zum brasilianischen Polizeijournalismus hebt hervor, wie die beliebtesten Programme die hohen Kriminalitätsraten des Landes kritisieren und sich dabei häufig auf eine angeblich geringe Tödlichkeit der Polizeikräfte konzentrieren, obwohl die Bilder von massiver rassistischer Gewalt in denselben Medien das Gegenteil beweisen.
Rüdiger ordnet diese Fernsehprogramme in das politische Panorama Brasiliens vor und nach der Diktatur ein und hebt dabei einen Wandel in den Prioritäten der Medien hervor. Wie der Forscher feststellt, hat sich die brasilianische Medienlandschaft zunehmend den Marktkräften und dem Sensationalismus unterworfen und das Land in einen „per Satellit übertragenen Zirkus des Grauens” verwandelt.
Desensibilisierung nimmt mit den sozialen Netzwerken neue Konturen an
Im 21. Jahrhundert nimmt diese Desensibilisierung mit den sozialen Netzwerken neue Konturen an. Inhalte, die früher auf Fernsehen und Printmedien beschränkt waren, passen nun in die Handfläche und überschwemmen Smartphones über soziale Netzwerke und andere Anwendungen. Rassistische Darstellungen staatlicher und polizeilicher Gewalt verbreiten sich und stellen Polizisten als Helden und „Kriminelle” als abweichende Körper dar. Die Folge ist die Verbreitung moralischer Panik und die Verstärkung der Unterstützung eines Teils der Bevölkerung für diese Gewalt. Die Desensibilisierung gegenüber gewalttätigen Bildern gegen schwarze Körper ist ein schrittweiser Prozess. Er beginnt mit den Samen rassistischer Ideologie, die über Generationen hinweg wachsen und sich verändern. Die Form entwickelt sich weiter – von Karikaturen über Polizeifotos bis hin zu viralen Videos –, aber die giftige Wurzel bleibt: die anhaltende symbolische Verbindung zwischen Schwarzsein, Gewalt und Bestrafung.
Die Lehre daraus ist, wie Audre Lorde und Malcolm X lehren, dass die Befreiung der schwarzen Bevölkerung ein Kampf von unendlicher Komplexität ist – sowohl gegen die äußeren Kräfte der Entmenschlichung als auch gegen die verinnerlichten unterdrückerischen Werte. Ein jahrhundertealter Konflikt, der oft auf das Medienspektakel reduziert wird. Die symbolische Überwindung dieser Darstellungen hängt von der Verbreitung alternativer Narrative und der Stärkung unabhängiger und schwarzer Medien ab. Während die Mainstream-Medien ihr historisches Muster wiederholten, indem sie über den Tod von „60 Banditen” berichteten und von der Barbarei profitierten – indem sie als „Messerschärfer” fungierten, wie Fabiana Moraes betont –, wurde die Realität auf andere Weise rekonstruiert. Anwohner und Vertreter von Medien wie Voz das Comunidades bargen die Leichen. Eine Szene, die, wie der Aktivist Raull Santiago bemerkte, „in die Horrorgeschichte Brasiliens eingeht”.


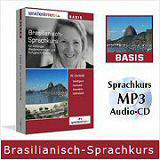
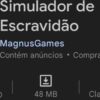







































 © 2009 – 2025 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2025 agência latinapress ist ein Angebot von
Für diese News wurde noch kein Kommentar abgegeben!