Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt auf die COP 30 in Brasilien vorbereiten, sind die Meeresökosysteme des Gastgeberlandes durch die wachsende fossile Brennstoffindustrie bedroht. Eine neue Analyse zeigt, wie insbesondere die Offshore-Ölförderung in Brasilien eine Spur chronischer Umweltverschmutzung hinterlässt – mindestens 179 Ölteppiche seit 2017, stark zunehmender Schiffsverkehr und alarmierende Methanemissionen. Dieses Problem ist sicherlich nicht auf Brasilien beschränkt, aber dieses Land ist auch mit außergewöhnlichem Naturreichtum gesegnet – dem Amazonas-Regenwald, den Pantanal-Feuchtgebieten und einigen der artenreichsten Meeresökosysteme der Welt – und verfolgt gleichzeitig eine kohlenstoffintensive Energieexpansion, die mit dem im wegweisenden Pariser Abkommen von 2015 festgelegten Ziel der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C unvereinbar ist.
Untersuchungen unter Verwendung von Satellitenbildern und Schiffsverfolgungsdaten dokumentierten ein chronisches Verschmutzungsproblem, das weitgehend unbemerkt geblieben ist. Von den 179 identifizierten Ölteppichen stammten 131 von Schiffen, wobei Öltanker und Ölfelddienstschiffe für fast die Hälfte der nachweisbaren Quellen verantwortlich waren. Dabei handelt es sich nicht um zufällige Verschmutzungen. Ein Großteil der Beobachtungen deutet darauf hin, dass es sich um die absichtliche Einleitung von ölhaltigem Abwasser durch kommerzielle Reeder handelt, die sich trotz internationaler Beschränkungen seit Jahrzehnten der Strafverfolgung entziehen. Diese Verschmutzung bedroht genau die Ökosysteme, die die Küstengemeinden ernähren und Brasiliens florierende Küstentourismusindustrie ermöglichen.
Das Ausmaß der Offshore-Expansion Brasiliens verstärkt diese Risiken dramatisch. Die Ölproduktion stieg zwischen 2014 und 2024 um 49 Prozent, während die Erdgasproduktion um 78 Prozent zunahm. An einer Offshore-Produktionsanlage im Santos-Becken stieg der Schiffsverkehr nach Aufnahme des Betriebs um 430 Prozent. Jede neue Offshore-Anlage erfordert mehr Tanker, mehr Service-Schiffe, mehr Küsteninfrastruktur – jedes Element trägt zur Verschmutzung der brasilianischen Gewässer und ihrer bemerkenswerten Artenvielfalt bei. Der Wanderkorridor der Buckelwale im Südwestatlantik verläuft durch die stark industrialisierten Becken von Campos und Santos, wo 73 Ölteppiche, 49 schwimmende Produktionsschiffe und 20 operative Plattformen beobachtet wurden. Eine Analyse identifizierte 20 wichtige Gebiete für Meeressäugetiere, die mehr als ein Viertel der ausschließlichen Wirtschaftszone Brasiliens abdecken – doch nur 6 Prozent dieser kritischen Lebensräume fallen unter Meeresschutzgebiete, sodass 94 Prozent ungeschützt bleiben.
Die Diskrepanz zwischen dem ehrgeizigen Versprechen des Landes, bis 2030 rund 30 Prozent seiner Gewässer zu schützen, und der Realität der expandierenden Offshore-Ölförderung in ökologisch sensiblen Gebieten wirft grundlegende Fragen darüber auf, wie diese Verpflichtungen miteinander vereinbar sind. Am besorgniserregendsten sind vielleicht die neuen Erkenntnisse über Methanemissionen. Bei einer einzigen Datenerfassung durch die Satellitensensoren von Carbon Mapper über dem Santos-Becken im April 2025 wurden drei gleichzeitige Methanwolken aus Offshore-Infrastrukturen identifiziert – jede davon qualifiziert sich als Super-Emittent. Erkenntnisse aus terrestrischen Öl- und Gasinfrastrukturen, für die viel mehr Daten verfügbar sind, deuten darauf hin, dass diese Emissionen routinemäßig auftreten könnten, was auf ein bedeutendes und unterberichtetes Klimaproblem hindeutet.
Nun hat die brasilianische Umweltbehörde der staatlichen Ölgesellschaft Petrobras die Genehmigung erteilt, mit Probebohrungen in der Nähe der Mündung des Amazonas zu beginnen – eine Entscheidung, die eine Debatte ausgelöst hat und die allgemeinen Spannungen zwischen den Zielen Brasiliens für die wirtschaftliche Entwicklung und seiner internationalen Führungsrolle im Klimaschutz als Gastgeber der COP30 widerspiegelt. Der Weg in die Zukunft muss nicht vorbestimmt sein. Brasilien hat die Chance, sich von diesem extraktiven Erbe abzuwenden und sich einer Zukunft zuzuwenden, in der der Reichtum der Ozeane an gesunden Riffen, florierenden Fischereien, widerstandsfähigen Küstengemeinden und geschützter mariner Biodiversität gemessen wird. Die ökologisch lebenswichtigen Ressourcen des Landes – von Korallenriffen über Mangrovenwälder bis hin zu wichtigen Lebensräumen für Meeressäugetiere – sind Vermögenswerte, die bei entsprechendem Schutz zu nachhaltigem Wohlstand führen können. Diese Chance ist jedoch zeitlich begrenzt.
Zumindest müssen die Regierungen die Subventionen für die fossile Brennstoffindustrie einstellen und Wettbewerbsgleichheit mit erneuerbaren Energien herstellen. Noch wirksamer wäre es, diese Subventionen umzuwidmen, um die Entwicklung erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Die Entwicklungsbanken, die diese Projekte finanzieren, müssen strengere Anforderungen an die Überwachung von Ölverschmutzung, Luftverschmutzung und Methanemissionen stellen, mit klaren Standards für schnelle Reaktion und Sanierung sowie durchsetzbaren Zeitplänen für den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. Das Problem der Verschmutzung durch Schiffe erfordert internationale Zusammenarbeit. Brasilien könnte eine Führungsrolle übernehmen, indem es sich für ein Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen zur Bekämpfung der Ölverschmutzung einsetzt, das sich an dem erfolgreichen Rahmenwerk zur Bekämpfung der illegalen Fischerei orientiert.
Im Rahmen eines solchen Übereinkommens würden Schiffe, die irgendwo als umweltverschmutzend registriert sind, bei der Einfahrt in einen Hafen eines Unterzeichnerstaates mit Konsequenzen rechnen müssen – wodurch die Lücken in der Durchsetzung, die Betreiber derzeit durch Billigflaggen ausnutzen, effektiv geschlossen würden und ein erheblicher Anreiz geschaffen würde, nicht mehr wie bisher weiterzumachen. Wir müssen auch die Ursache bekämpfen: Handelsschiffe, die weiterhin Schweröl verbrennen, den schmutzigsten und klimaschädlichsten Kraftstoff, der es gibt. Die Vorschrift, sauberere Kraftstoffe zu verwenden, würde einen Großteil dieses chronischen Verschmutzungsproblems beseitigen. Der Bau von Energieanlagen an der brasilianischen Küste bedroht Mangroven, Seegraswiesen und Salzwiesen – Lebensräume für blauen Kohlenstoff, die wichtige Kohlenstoffsenken sind. Ihre Existenz trägt zur Lösung des Klimaproblems bei, ihre Zerstörung beschleunigt es. Dieselben Lebensräume dienen als Kinderstube für kommerziell wichtige Fischarten und schützen die Küsten vor Sturmfluten.
Da Brasilien Gastgeber der COP 30 ist, bietet diese Konferenz die Gelegenheit, Maßnahmen mit Verpflichtungen in Einklang zu bringen – um zu zeigen, dass der Schutz von 30 Prozent der Land- und Wasserflächen bis 2030 bedeutet, dem Umweltschutz und dem langfristigen Wohlergehen sowohl der eigenen Bürger als auch der Weltgemeinschaft wirklich Priorität einzuräumen. Die Beweise sind überzeugend. Es steht viel auf dem Spiel. Jetzt muss gehandelt werden.


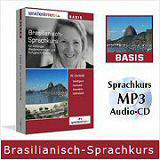








































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!