Lange vor dem Drogenhandel schufen repressive Maßnahmen und die Militarisierung des Strafvollzugs während der Diktatur von 1964 das Umfeld, in dem die ersten kriminellen Banden des Landes entstanden. Vor diesem Hintergrund erlebt Brasilien seit Jahrzehnten ein Wachstum dieser Banden, insbesondere in den Vororten der Großstädte. Das meiste, was über diese Gruppen berichtet wird, erscheint in sensationslüsternen Nachrichten oder in Äußerungen von Behörden, die sie als äußerst gewalttätige Organisationen bezeichnen, die vom Drogen- und Waffenhandel profitieren. Es gibt jedoch auch andere Sichtweisen auf dieses Phänomen. Sie veranlassen Forscher, die Rolle des brasilianischen Staates bei seiner Entstehung und Aufrechterhaltung zu überdenken.
Falange Vermelha und Comando Vermelho: Widerstand im Gefängnis während der Diktatur
In einer Doktorarbeit an der Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz hat ein Experte die Geschichte der kriminellen Banden in Rio de Janeiro untersucht. Anstatt diese Banden nur als Produkt von Bösartigkeit oder purer Kriminalität zu betrachten, kann man sie auch als Formen des sozialen Widerstands verstehen, die innerhalb des Gefängnissystems entstanden sind. Dies ist der Fall beim Comando Vermelho (CV), das Ende der 1970er Jahre im Gefängnis Ilha Grande in Rio de Janeiro gegründet wurde. Diese Gruppe entstand aus dem Zusammenleben von gewöhnlichen Häftlingen und politischen Gefangenen, die unter die Nationalen Sicherheitsgesetze der Militärdiktatur fielen. Die Absicht der Militärs während der Diktatur war es, durch die Unterbringung in denselben Zellen den Eindruck zu erwecken, dass es keine politischen Gefangenen im Land gäbe, und den politischen Einfluss der linken Militanten zu schwächen. Das Ergebnis war jedoch das Gegenteil: Die gewöhnlichen Häftlinge begannen, sich kollektiv zu organisieren, inspiriert von der Disziplin und den Strategien der politischen Häftlinge.
So begannen sie, grundlegende Rechte und bessere Lebensbedingungen innerhalb des Gefängnisses einzufordern. Dieser Organisationsprozess, der durch die erste präfraktionelle Gruppe, die Falange Vermelha, bekannt wurde, stellte ein Projekt für soziale Gerechtigkeit innerhalb des Gefängnisses dar. Mit dem Amnestiegesetz wurden nur die politischen Häftlinge freigelassen. Die gewöhnlichen Häftlinge blieben unter prekären Bedingungen und ohne Antwort seitens des Staates zurück. Angesichts dessen griffen sie zu radikaleren Strategien. In diesem Kontext verwandelte sich die Falange in Comando Vermelho, die erste brasilianische Fraktion. Der Kampf für soziale Gerechtigkeit, der zuvor auf Dialog ausgerichtet war, organisierte sich nun mit Waffengewalt und kriminellen Mitteln, da die Häftlinge ohne die politischen Gefangenen von der Gefängnisleitung nicht mehr gehört wurden. Die Fraktion legte einen Verhaltenskodex fest und schuf kollektive Finanzierungsmechanismen wie die „Kasse” (ein Teil der Gewinne aus Diebstählen sollte für die Freilassung inhaftierter Kameraden verwendet werden). Nach der Verlegung ihrer Anführer durch die Leitung in andere Gefängnisse breitete sich die Fraktion im gesamten Strafvollzugssystem und später in den Favelas von Rio aus.
Die Ausbreitung und der Wandel der Fraktionen
Nach dem Comando Vermelho entstanden weitere Fraktionen wie Terceiro Comando und die Amigos dos Amigos (ADA), die alle dieses ursprüngliche Modell übernahmen. Die Ankunft des Kokainhandels verschärfte die Territorialstreitigkeiten und verwandelte den Kampf um soziale Gerechtigkeit in eine Marktlogik. Die Banden dehnten sich über Rio de Janeiro hinaus aus, setzten Regeln durch, kontrollierten Streitigkeiten und regelten das Leben in den Gemeinden. Heute gibt es Banden, die noch immer ein Projekt der sozialen Gerechtigkeit verfolgen, während andere eine Bandenstruktur annehmen, aber vorwiegend kriminelle und finanzielle Ziele verfolgen. Entgegen der Vorstellung einer Abwesenheit des Staates in diesen Gebieten ist vielmehr zu beobachten, dass die Banden in ständiger Spannung oder Absprache mit öffentlichen Akteuren stehen, sei es durch Konfrontationen oder Korruptions-Systeme. Dieses Szenario offenbart das Scheitern eines Sicherheitsmodells, das ausschließlich auf Repression basiert. Die Factions auf bloße Banden zu reduzieren, ignoriert ihre politisch-soziale Herkunft und die Rolle des Staates bei ihrer Konsolidierung – sei es durch die Repression der Diktatur oder durch die Vernachlässigung der ärmsten Bevölkerungsschichten. Für viele junge Menschen ohne Zugang zu formaler Arbeit bieten die Banden trotz der Risiken eine Alternative. Die Ignoranz dieses Kontextes legitimiert gewalttätige Praktiken wie tödliche Operationen in den Favelas, die den Kreislauf von Ausgrenzung und Tod weiter nähren.
Das staatliche Vorgehen und die Reproduktion der Banden
Mit der Verschärfung der Auseinandersetzungen zwischen den Banden begann die Gefängnisverwaltung von Rio de Janeiro, diese innerhalb der Haftanstalten zu trennen. Die Maßnahme war umstritten und wurde von vielen als Beweis für das Versagen des Staates angesehen, da er eine solche Trennung institutionalisierte. Anfang der 2000er Jahre versuchte das Sekretariat für Strafvollzug (SEAP), diese Logik mit dem Projekt einer „Gefängnis ohne Banden” zu durchbrechen. Das Gefängnis Hélio Gomes wurde von Bandenmitgliedern geräumt und nahm nur noch sogenannte „Sicherheitshäftlinge” auf – ehemalige Polizisten, Vergewaltiger und andere von den Banden abgelehnte Gruppen. Der Vorschlag sah Berufsbildungs- und Wiedereingliederungsprogramme vor, die jedoch eingestellt wurden. Ohne wirksame Maßnahmen und angesichts der prekären Lage entstanden neue Macht- und Ausgrenzungsdynamiken. Im Jahr 2004 brach eine Rebellion aus, in deren Verlauf die Häftlinge eine neue Gang gründeten: die Povo de Israel (PVI). Die PVI wurde von denen gegründet, die nicht mit Vergewaltigern oder ehemaligen Polizisten in Verbindung gebracht werden wollten, und entstand gerade aus dem Versuch des Staates, das Gefängnisumfeld zu neutralisieren.
Ein weiteres Beispiel für eine gescheiterte Politik in diesem Bereich waren die Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Obwohl sie mit dem Ziel der Befriedung und Vertreibung der Banden aus den Favelas ins Leben gerufen wurden, kam es in vielen Fällen lediglich zu einer Verlagerung der Gewalt in andere Regionen. In anderen Fällen gelang es der lokalen Bande, korrupte Vereinbarungen zu treffen, die die Fortsetzung des Drogenhandels vor Ort ermöglichten. Mit dem Abzug der UPPs wurden Machtvakuums von Banden und Milizen umkämpft. Diese Beispiele zeigen, dass der Staat nicht gänzlich gegen die Banden ist. Im Gegenteil, verschiedene staatliche Maßnahmen – sei es durch Unterlassung, schlecht geplante oder schlecht umgesetzte Politik – haben zur Bildung und zum Fortbestehen der Banden beigetragen. Die Gewalt der Banden entsteht nicht aus dem Nichts: Sie ist das Ergebnis historischer Strukturen der Unterdrückung und Ungleichheit. Die Fraktionen sind in diesem Zusammenhang Symptome – und nicht die Ursache – für das Perverseste in unserer Gesellschaft. Die Geschichte dieser Gruppen zu verstehen bedeutet auch, die Grenzen, Widersprüche und Komplizenschaften der öffentlichen Sicherheitspolitik in Brasilien zu verstehen. Die Entstehung und Fortdauer der Fraktionen kann nicht verstanden werden, ohne die aktive, direkte oder indirekte Beteiligung des Staates selbst zu berücksichtigen.


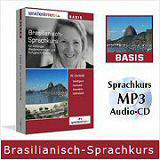







































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!