Die Zahl der Internetnutzer weltweit steigt stetig an. In den vergangenen zehn Jahren ist die Nutzerzahl insgesamt um etwa 2,7 Milliarden gestiegen. Im Jahr 2025 nutzen weltweit etwa 5,56 Milliarden Menschen das Internet, was etwa 67,9% der Weltbevölkerung entspricht. Das bedeutet, dass immer noch ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung, etwa 32%, keinen Zugang zum Internet hat. Die Internetnutzung in Lateinamerika ist weit verbreitet, aber es gibt große Unterschiede zwischen den Ländern und innerhalb der einzelnen Regionen. Während die durchschnittliche Internetdurchdringung hoch ist, haben viele Menschen nur begrenzten oder teuren Zugang zu Informationen und Diensten außerhalb von sozialen Netzwerken wie Meta und WhatsApp. Das lateinamerikanische Land mit den meisten Internetnutzern ist immer noch Brasilien, mit 181,8 Millionen Nutzer, gefolgt von Mexiko mit 100,6 Millionen und Argentinien mit 39,79 Millionen.
Acht von zehn Internetnutzern in Brasilien nutzen laut Daten des Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (NIC.Br) aus dem Jahr 2024 regelmäßig soziale Netzwerke. Während Sie surfen, sammeln soziale Netzwerke still und leise viel mehr Informationen, als wir bewusst preisgeben. Diese Daten werden in mehreren Ebenen erfasst. Die „nullte“ Ebene entspricht den grundlegenden Informationen, die wir angeben – Name, Alter, Interessen, unser Netzwerk. Auf dieser Grundlage wird in den anderen Ebenen ein Universum von Verhaltensdaten überwacht. Die Netzwerke beobachten, was wir liken, teilen, kommentieren, ansehen und wie viel Zeit wir mit einem Beitrag oder Video verbringen. Diese Muster werden statistisch mit denen anderer Nutzer verglichen, und daraus werden Rückschlüsse auf unsere Vorlieben, Wünsche und sogar Aspekte unserer Persönlichkeit gezogen. Der dänische Medienberater Thomas Baekdal nennt dies Daten erster Ordnung. Sie werden von den Plattformen erstellt, indem sie alles, was sie aus unseren Aktivitäten extrahieren, verfeinern und so Rückschlüsse darauf zulassen, was wir bereit sind, auszugeben. Diese Daten werden in Profilen organisiert, die automatisiert in Mikrosekunden an Werbetreibende verkauft werden.
Sie müssen nicht zu 100 % richtig liegen; wenn sie sich irren, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass wir eine Anzeige ignorieren. Die zweite Ebene liegt also in der kommerziellen Beziehung der Plattformen zu Werbetreibenden auf der Grundlage unserer Daten. Aus allem, was sie über uns wissen, und dem, was sie daraus ableiten, erstellen die Plattformen sehr detaillierte Profile. Sie müssen nicht unbedingt wissen, wer Sie sind, aber sie wissen, dass Sie, wenn sie Ihren Geschmack und den richtigen Moment treffen, ein Video ansehen, auf eine Anzeige klicken oder etwas kaufen könnten. Das ist ein bisschen Demografie, ein bisschen Psychografie und ein bisschen Gerissenheit. Es gibt noch eine dritte Ebene, die Cookies von Drittanbietern, die noch invasiver sind als die der Plattformen. So verfolgen Sie Werbeanzeigen von einer Website zur nächsten. Cookies sind kleine Dateien, die Websites in Ihrem Browser ablegen, wenn Sie eine Seite besuchen. Sie dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen, und werden so zu einer Art Logbuch über alles, was Sie auf der Website getan haben.
Sie können von der besuchten Website selbst stammen: Wenn Sie zu einer Nachrichtenwebsite zurückkehren, werden die Links, auf die Sie bereits geklickt haben, violett statt blau angezeigt. Im lukrativen Geschäft mit Cookies von Drittanbietern können die Cookies, die von der von Ihnen besuchten Website auf Ihrem Computer gespeichert werden, jedoch auch von Werbenetzwerken stammen, die auch auf anderen Websites präsent sind. Diese Netzwerke stehen nicht in direkter Verbindung zu Ihnen, sondern zu den Websites, die Sie besuchen. Wenn dasselbe Cookie-Unternehmen beispielsweise eine Nachrichten- und eine Food-Website überwacht, sieht es, wer beide Websites besucht und wer nicht. Aus diesem Grund verwenden so viele Websites Pop-ups, in denen Sie um Ihre Zustimmung zu Cookies gebeten werden: Wenn sie keine Cookies von Drittanbietern verwenden, müssen sie nicht um Erlaubnis fragen.
Diese Unternehmen sammeln Daten über Ihr Surfverhalten, um ein vermarktbares Profil von Ihnen zu erstellen. Auf einer höheren Ebene werden diese Daten verkauft und mit externen Datenbanken abgeglichen, z. B. mit Daten aus Kreditauskunfteien, Ihrem Kaufverhalten und sogar Gesundheitsdaten. So entstehen Datenbroker. Sie haben nichts mit Ihrer Internetnutzung oder den Websites zu tun, die Sie besuchen. Es handelt sich um Unternehmen, die all diese Daten sammeln, um vollständige Profile zu verkaufen, die oft Namen, Sozialversicherungsnummern, Telefonnummern oder Namen von Verwandten enthalten. Dieser Markt fördert sowohl legitime Werbung als auch Betrug und Schwindel, sei es über Werbung (84 % der Beschwerden über Werbung betreffen digitale Anzeigen) oder auf direkterem Wege. Personen, die beispielsweise Betrügereien über WhatsApp begehen, haben oft das Profil des Opfers mit Foto und allem Drum und Dran auf einer Website gekauft, die dies anbietet. Die Personen in diesen Datenbanken haben keine Ahnung, dass sie als Produkt verkauft werden. Ein Teil der Menschen, die davon wissen, lässt sich von der falschen Vorstellung leiten, dass „alle unsere Daten bereits öffentlich sind”. Das ist ein Trugschluss: In den schwerwiegendsten Fällen wurden sie gestohlen oder unter falschen Vorwänden erlangt.
Insel personalisierter Reize
Die unmittelbarste Auswirkung ist, dass die Inhalte, die Ihnen in sozialen Netzwerken angezeigt werden, nicht neutral sind. Die Plattformen haben ein Interesse daran, Sie so lange wie möglich auf ihrer Seite zu halten, weil sie Ihnen dann mehr Werbung zeigen können. Sie sehen mehr Beiträge von Freunden, mit denen Sie am meisten interagieren, und nicht von denen, die Sie am meisten vermissen. In der Regel interagieren Sie mehr mit denen, die die Plattform am häufigsten nutzen, mehr Unsinn posten oder engagierter sind. Wenn es sich statt um einen Freund um ein Thema handelt, wird die Plattform Ihnen Themen anzeigen, bei denen Sie mehr Anzeichen dafür zeigen, dass sie Ihnen gefallen – Likes, Shares. Wenn Sie YouTube in einem neu installierten Browser öffnen, ohne sich anzumelden, sehen Sie ein Abbild der Parallelwelt dessen, was in Brasilien am meisten Engagement hervorruft. Sobald die Plattform Sie besser kennenlernt, personalisiert sie alles, was sie kann, um Sie dort zu halten. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Daten sammelt sie, desto verführerischer wird sie und desto länger bleiben Sie dort. Dieser Kreislauf ist teuflisch.
Diese Logik wird mit der von Spielautomaten verglichen. Der unendliche Feed ist eine dieser Taktiken. Die aggressivsten Plattformen „bestrafen” auch Links. Facebook beispielsweise reduziert die Reichweite von Beiträgen mit Links, weil sie den Nutzer von der Plattform wegführen. Instagram erlaubt in normalen Beiträgen gar keine anklickbaren Links. Twitter, jetzt X, bevorzugt ebenfalls native Inhalte. Das Ziel ist es, den Nutzer in der Blase zu halten, um weiterhin Daten sammeln und Werbung verkaufen zu können. Laut der Autorin Shoshanna Zuboff verändern Plattformen das Verhalten der Nutzer, um sie berechenbarer zu machen und besser definieren zu können, was ihnen angeboten werden soll. Das Problem dabei ist, dass dadurch sehr geschlossene Blasen entstehen. Es ist ein System, das jeden von uns zu einer Insel mit personalisierten Reizen macht.
Algorithmen, die zu extremen Ansätzen führen
Plattformen verwenden den Begriff „Transparenz” sehr dehnbar. Es gibt die Transparenz gegenüber dem Verbraucher – die Möglichkeit, zu sehen, in welche Werbekategorien man fällt –, aber sie ist schwer zugänglich, in den Einstellungen versteckt und mit vagen Formulierungen versehen. Die öffentliche Transparenz darüber, wie die Plattformen funktionieren, wird hingegen systematisch abgebaut: Die API von Twitter, mit der man recherchieren konnte, wer mit wem über bestimmte Themen sprach, wurde mit der Übernahme durch Elon Musk im Jahr 2022 abgeschafft. Die Schließung gegen Zahlung einer überhöhten Gebühr war der Sargnagel für diese Studien, sodass wir nun nicht mehr in der Lage sind, Desinformationskampagnen und Extremismus in Echtzeit zu überwachen und Forderungen nach Rechenschaftspflicht zu untermauern. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben soziale Netzwerke den Zugang zu verlässlichen Informationen erschwert. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, nicht mehr direkt zu den Nachrichtenproduzenten zu gehen, sondern darauf zu warten, dass die Plattformen ihnen das Wesentliche liefern. Dies hat nicht nur dem Journalismus geschadet, sondern auch den Mythos verstärkt, dass „alles Wichtige schon zu mir kommt” – eine Idee, die um 2012 entstand, als wir alle von sozialen Netzwerken begeistert waren.
Allerdings ist das, was in den Netzwerken am meisten zirkuliert, nicht das Wesentliche, sondern das, was am meisten angeklickt wird und starke Emotionen hervorruft. Jonah Berger, Marketingprofessor an der University of Pennsylvania (USA) und Autor des Buches „Contagious: Why Things Catch On”, zeigt dies in seiner Studie deutlich. Nachrichten mit einer höheren emotionalen Ladung werden häufiger gelesen und geteilt und haben eine größere Chance, viral zu gehen, insbesondere wenn sie Wut hervorrufen. Diese permanente Mobilisierung hat politische, soziale und sogar zwischenmenschliche Konsequenzen. Und natürlich bevorzugt der Algorithmus genau diese Art von Inhalten, weil sie Engagement hervorrufen. Der Algorithmus will nicht, dass Sie sich informieren, sondern dass Sie reagieren, indem Sie liken, teilen und kommentieren, solange alles innerhalb des ummauerten Gartens der Plattformen bleibt. Politisch führt dies zu einer asymmetrischen Demobilisierung und Mobilisierung. Zeynep Tufekci, Professorin für Soziologie und öffentliche Kommunikation an der Princeton University (USA), hat auf YouTube gezeigt, dass dieses Modell einen Weg in den Extremismus ebnen kann. Man beginnt mit der Suche nach Videos über gesunde Ernährung, und wenn man den Empfehlungen der Plattform folgt, wird der Ton allmählich schärfer, bis schließlich Verschwörungstheorien über Impfstoffe angezeigt werden. Der Algorithmus schiebt die extremsten Inhalte zu diesem Thema nach vorne, weil sie die meiste Aufmerksamkeit erregen. Je mehr man den Vorschlägen des Algorithmus folgt, desto vorhersehbarer wird das eigene Verhalten und desto leichter wird es, einen mit Werbung anzusprechen. Selbst wenn die eigene Familie einen nicht mehr unterstützt.
Sprachmaschinen
KI ist in diesen Prozessen schon seit langem präsent, insbesondere in Form von maschinellem Lernen (machine learning). Sie analysiert insgesamt, was gesehen, angeklickt und ignoriert wurde, vergleicht dies und nutzt es, um vorherzusagen, was Menschen mit ähnlichen Vorlieben als Nächstes sehen möchten. Das gilt für soziale Netzwerke, Netflix und jede Plattform, die Inhalte empfiehlt. Im schlimmsten Fall wählen Sie etwas anderes auf derselben Plattform aus, was für sie ein weiteres wichtiges Signal ist, oder Sie schalten den Fernseher aus und gehen schlafen. Mit generativer KI wird das Szenario noch komplexer. Es gibt bereits Menschen, die diese Modelle nutzen, um Inhalte in großem Umfang zu produzieren – Videos, Bücher, Podcasts –, manchmal mit falschen Informationen. Im Jahr 2023 erschienen am Tag nach der Bekanntgabe zehn „Biografien” von Claudia Goldin, Gewinnerin des Nobelpreises für Wirtschaft, einige davon von KI generiert. Diese Modelle simulieren eine sehr überzeugende Sprache, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten auf den Bildschirm geworfen wird. Wer generative KI nutzt, ohne deren Ergebnisse sorgfältig zu überprüfen, läuft Gefahr, Desinformation in der Welt zu verbreiten. Wer hingegen die Ergebnisse der Sprachfüllmaschinen sorgfältig überprüft und korrigiert, riskiert, die Zeit zu verlieren, die er durch den Einsatz des digitalen Assistenten gewonnen hat. Oder sogar noch mehr.
Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist es, Transparenz auf Plattformen zu gewährleisten: Sie müssen verpflichtet werden, ihre Algorithmen für Audits zu öffnen – damit wir wissen, wer was sieht, warum er es sieht und wer dafür bezahlt hat –, und die Daten der Beiträge freizugeben. So wie es Bluesky oder das inzwischen eingestellte Twitter getan haben, was Facebook und Instagram nie getan haben. Ebenso ist es unerlässlich, Influencer zu regulieren, deren Macht, Produkte, Ideen und sogar Wetten zu verkaufen, wie in der CPI das Bets deutlich wurde, ohne klare Regulierung ausgeübt wurde, indem sie das in der Pandemie entstandene Vertrauensverhältnis oft missbräuchlich kommerziell ausnutzten, was Grenzen erfordert. Nur wenn man diese Funktionsweise der Netzwerke versteht und auf dieser Grundlage Gesetze erlässt, anstatt sich nur auf die traditionelle Kommunikation zu stützen, kann diese Eskalation der Vulgarität eingedämmt werden. Gleichzeitig gibt es soziale Netzwerke mit einer anderen Dynamik. Bluesky beispielsweise verwendet keine Viralitätsalgorithmen: Wer morgens etwas postet, erreicht nur diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt online sind, und Reposts sind notwendig, um die Reichweite zu erhöhen. Es werden weder Links bestraft noch kontroverse Inhalte bevorzugt, was die Umgebung weniger toxisch macht. Automatische Moderationswerkzeuge ermöglichen es, beleidigende Kommentare zu entfernen, Community-Listen zu folgen und Profile massenhaft zu blockieren. Mastodon hat ein noch offeneres Protokoll als Bluesky und ermöglicht viel flexiblere Moderationsmöglichkeiten, aber viele hielten es für ein zu technisches Netzwerk, sodass es sich in Brasilien außerhalb der technisch versierten Communities nicht durchsetzen konnte.
Die Hoffnung besteht, aber sie hängt von uns ab: Wir müssen besser verstehen, wie diese Plattformen funktionieren, Transparenz einfordern, Regulierungsinitiativen unterstützen und gesündere Umgebungen für die öffentliche Debatte suchen. Es gibt viele gute Forscher, die Wege aufzeigen – wie die Forscher Letícia Cesarino (UFSC), Rosana Pinheiro Machado, Francisco Brito Cruz (Gründer des InternetLab und heute unabhängig), Rafael Evangelista (Labjor/Unicamp) und viele andere kritische und technische Stimmen. Soziale Netzwerke prägen, was wir sehen, was wir denken und sogar wie wir uns verhalten. Wir können diese Macht nicht in den Händen von Unternehmen lassen, die gekauft werden oder die Schutzmechanismen für Nutzer zerstören können. Wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir uns informieren, kommunizieren und unsere Weltanschauung aufbauen wollen, indem wir versuchen, unsere Abhängigkeit von den „Big Tech”-Unternehmen schrittweise zu verringern und nach Alternativen zu suchen. Diese Alternativen gibt es, aber sie verkaufen sich schlecht. Noch wichtiger wäre es, häufiger die sozialen Bindungen zu lösen, sich von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten, ohne die Verpflichtung, etwas viral zu machen, und ohne von Werbung belästigt zu werden. Das Leben offline ist es, was allem, was auf dem Bildschirm geschieht, einen Sinn gibt.


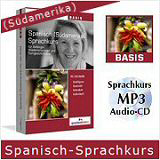










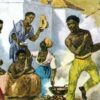





























 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!