Seit dem Westfälischen Frieden (Vertragswerk von 1648, das zwei große europäische Kriege beendete) verankert die Souveränität das Recht jedes Staates, die Hoheitsgewalt über sein Territorium und seine Bevölkerung auszuüben. Auf rechtlicher Ebene begründet sie die formale Gleichheit zwischen den Staaten; auf politischer Ebene wird ihre Anwendung durch asymmetrische Machtverhältnisse bedingt. Diese Spannungen werden in der aktuellen internationalen Ordnung, in der Souveränität nicht nur ein Rechtsprivileg, sondern auch ein ständiger Streitpunkt ist, noch deutlicher. In der Praxis wird Souveränität durch externe Druckfaktoren geprägt – wirtschaftliche, normative und institutionelle. Die Bewahrung der Grenzen reicht nicht mehr aus. Selbstbestimmung erfordert die Fähigkeit, auf extraterritoriale Maßnahmen, Sanktionen und Normen dominanter Mächte zu reagieren. In diesem Zusammenhang haben die Vereinigten Staaten unter Donald Trump eine Neugestaltung der Formen der hemisphärischen Einflussnahme vorgenommen und damit den Grad der Autonomie der Länder in Lateinamerika verändert. Instrumente wie Zölle, Sanktionen und regulatorische Auflagen werden nun regelmäßig eingesetzt, um das Verhalten von Partnern zu beeinflussen. Länder wie Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Panama und Kanada sehen ihre Souveränität als verhandelbare Variable, die davon abhängt, inwieweit sie die Erwartungen Washingtons erfüllen.
Bedingungen und Abhängigkeiten
Die derzeitige Präsidentschaft Trumps hat eine Logik der expliziten Konditionierung verschärft: Je größer die politische Konvergenz mit den Vereinigten Staaten, desto vielversprechender die wirtschaftlichen Zugeständnisse; je größer die Dissidenz, desto größer die Strafen. Der Fall Argentiniens veranschaulicht die Erwartung von Belohnungen auf der Grundlage ideologischer Affinität. Dennoch ist angesichts des volatilen Charakters der amerikanischen Außenpolitik, die mit Trump verschmilzt, nichts garantiert. Mexiko wurde durch Zölle unter Druck gesetzt, eine strengere Einwanderungspolitik zu verfolgen. Kolumbien erhielt Warnungen wegen seiner Drogenpolitik. Kanada, obwohl historischer Verbündeter, sah seine Souveränität wegen angeblicher Untätigkeit im Kampf gegen den Handel mit Fentanyl und wegen provokativer Äußerungen über seine mögliche „Integration” als 51. Bundesstaat der USA in Frage gestellt. Dieses Muster beschränkt sich nicht nur auf den amerikanischen Kontinent. Dänemark beispielsweise wurde wegen Grönland unter Druck gesetzt, was zeigt, dass die Logik des Feilschens sogar gegenüber europäischen Verbündeten angewendet wird.
In Brasilien wurde eine unterschiedliche Anwendung dieser Logik je nach der amtierenden Regierung beobachtet. Während der Amtszeit von Bolsonaro gab es eine Annäherung an Washington aufgrund ideologischer Affinitäten, jedoch ohne positive praktische Ergebnisse für den Handel oder die brasilianische Diplomatie auf internationaler Ebene. In der aktuellen Regierung, die ideologisch weit von Trumps Plattform entfernt ist, bleiben die Druckmittel bestehen, wenn auch in anderer Form. Ein symbolträchtiges Beispiel ist die kürzliche Aufnahme von Minister/Richter Alexandre de Moraes in die Sanktionsliste des Magnitsky-Gesetzes aufgrund von Vorwürfen, die über den ursprünglichen Geltungsbereich des Gesetzes hinausgehen. Die rechtliche Extraterritorialität greift in diesem Fall nicht auf militärische Gewalt zurück, sondern auf die Auferlegung von Normen und Sanktionen, um innenpolitische Entscheidungen zu beeinflussen. Es handelt sich um eine instrumentelle Nutzung der internationalen Legalität, um das Handeln öffentlicher Akteure zu konditionieren. Diese Vorgehensweise erinnert an die Logik der Monroe-Doktrin, die nicht mehr durch direkte militärische Interventionen zum Ausdruck kommt, sondern durch normative und wirtschaftliche Mechanismen. Länder, die sich nicht an die Richtlinien der Vereinigten Staaten halten, werden als dysfunktional bezeichnet; diejenigen, die sich anpassen, erhalten Kooperationsversprechen – die nicht immer eingehalten werden und fast immer mit Bedingungen und enormen Nachteilen für die Länder verbunden sind, die die Vorabvereinbarungen unterzeichnen.
Kampf um Autonomie und Widerstand
Die zunehmende Instrumentalisierung internationaler Normen durch hegemoniale Mächte – wie sie sich in den direkten Druckmaßnahmen der Vereinigten Staaten auf brasilianische Institutionen, insbesondere auf den Obersten Bundesgerichtshof durch Alexandre de Moraes, zeigt – stellt die Staaten vor die Herausforderung, ihre Strategien zur internationalen Integration zu überdenken. Im Falle Brasiliens erfordert dies die Stärkung der institutionellen Reaktionsfähigkeit, die Diversifizierung von Partnerschaften über die traditionellen Achsen – wie die USA und China – hinaus und die Durchsetzung eigener Agenden in verschiedenen multilateralen Arenen. Die Bewältigung des aktuellen Kontextes politischer und wirtschaftlicher Zwänge erfordert mehr als nur Bekundungen der Ablehnung. Es erfordert die Formulierung einer kohärenten und autonomen Außenpolitik, die von soliden Institutionen und diplomatischen Netzwerken gestützt wird, zu denen beispielsweise Indien, afrikanische Länder, Südkorea, Japan und die südostasiatischen Nationen gehören, sowie einen strategischen Dialog mit der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, trotz ihrer Ambivalenz.
Der Aufbau produktiver und technologischer Autonomie ist ebenso unverzichtbar, um den Handlungsspielraum im Inland angesichts des wachsenden normativen und regulatorischen Drucks von außen zu vergrößern. Es sei darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass man externem Druck ausgesetzt ist, an sich noch keine Verletzung der Souveränität darstellt. Das Problem liegt in der strukturellen Ungleichheit der internationalen Beziehungen, die die Fähigkeit zur Gegenwehr beeinträchtigt und jede reale Erwartung auf Gegenseitigkeit zunichte macht. In diesem Zusammenhang entsteht das Konzept der funktionalen Souveränität: die konkrete Fähigkeit, öffentliche Politik auf der Grundlage nationaler Interessen zu formulieren und umzusetzen, selbst unter widrigen Bedingungen und angesichts der Versuche, einseitig externe Normen durchzusetzen.
In diesem Szenario stehen die lateinamerikanischen Länder vor einer Zwickmühle. Sie müssen sich entscheiden, ob sie sich den externen Forderungen beugen und damit ihre Autonomie aufs Spiel setzen oder Widerstand leisten und die damit verbundenen politischen und wirtschaftlichen Kosten tragen wollen. Diese Strategien schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus. Es ist möglich – und notwendig –, sie pragmatisch zu kombinieren: Verhandlungen an Fronten, an denen es Spielraum für gegenseitige Gewinne gibt, wie im Handels- und Finanzbereich, ohne dabei die institutionellen Grundlagen aufzugeben, die die Integrität des Staates gewährleisten.


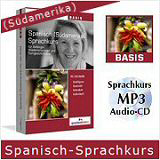







































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!