Von São Paulo bis Santiago arbeiten Gesetzgeber unter Hochdruck daran, ein einzigartiges lateinamerikanisches Modell zur Regulierung künstlicher Intelligenz zu entwickeln – ein Modell, das Rechte schützt, ohne Innovationen zu behindern, und das sich dagegen wehrt, nur eine weitere Kopie des Codes anderer zu werden. Jahrelang war künstliche Intelligenz auf dem legislativen Radar Lateinamerikas kaum zu erkennen. Sie wurde als Backend von Smartphone-Apps, als Schlagwort für Start-ups und als Problem des Silicon Valley angesehen. Diese Illusion zerbrach im vergangenen Herbst, als der Bürgermeisterwahlkampf in São Paulo durch eine Deepfake-Audioaufnahme auf den Kopf gestellt wurde, die die Stimme eines Kandidaten imitierte und sich wie ein Lauffeuer über WhatsApp und lokale Radiosender verbreitete. Niemand konnte sagen, wer sie erstellt hatte. Aber alle sahen die Folgen. Plötzlich war KI kein Zukunftsthema mehr – sie war da, flüsterte in Posteingängen und Kommentarspalten.
In Bogotá, Buenos Aires und Santiago läuteten die Alarmglocken. In Costa Rica beauftragte das Wahlgericht des Landes still und leise Datenwissenschaftler mit der Überwachung digitaler Wahlkampf Inhalte im Vorfeld der Wahlen 2026. In Brasilien entbrannte ein erbitterter öffentlicher Streit zwischen Regulierungsbehörden und Meta, wobei Brasília Zugang zu algorithmischen Quellcodes von Empfehlungsmaschinen forderte. Im Kern besteht ein gefährliches Vakuum. Ein im April veröffentlichter IWF-Index zeigte, dass Lateinamerika in vier entscheidenden Bereichen weit hinter der OECD und China zurückliegt: Breitbandzugang, Tech-Talente, F&E-Ausgaben und – vielleicht am dringendsten – Regulierung. Diese letzte Lücke birgt ein besonderes Risiko. Ohne feste Leitplanken könnte die Region zu einer Auffangstation für unregulierte KI-Systeme werden, wie sie von Brüssel blockiert, aber stillschweigend in den Favelas von Rio oder in Callcentern in Guatemala eingesetzt werden.
Weder Brüssel noch Silicon Valley: Ein dritter Weg zeichnet sich ab
Lateinamerika versucht nun, etwas anderes aufzubauen – weder eine Kopie des EU-KI-Gesetzes mit seinen extrem hohen Compliance-Kosten noch einen Neuanfang wie die USA unter Präsident Trump, wo Deregulierung im Namen der Innovation herrscht. Was die chilenische Senatorin Ximena Órdenes als „dritten Weg – schützend, aber fördernd“ bezeichnet, nimmt Gestalt an. Ihr Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum Transparenzvorschriften unterliegt und Sandbox-Programme für Entwickler eingeführt werden, um sensible Anwendungen wie medizinische Chatbots unter strenger staatlicher Aufsicht zu testen. In Brasilien geht der Gesetzentwurf noch weiter. Er enthält Bestimmungen zur zivilrechtlichen Haftung und würde KI-Systeme, die in portugiesischer Sprache betrieben werden, dazu verpflichten, auf lokale Dialekte trainiert zu werden – eine technische Änderung mit weitreichenden Auswirkungen auf die Fairness. In Kolumbien, Peru und Paraguay konzentrieren sich die Gesetzesentwürfe auf ein Thema: algorithmische Diskriminierung bei der Bonitätsbewertung und bei der Einstellung von Mitarbeitern. In Volkswirtschaften, in denen eine schlechte Bewertung einen Arbeitnehmer zurück in die Informalität werfen kann, steht viel auf dem Spiel.
Argentinien, das nach wie vor von einem finanziellen Chaos geprägt ist, verfügt über keine einheitliche nationale KI-Politik. Aber bei den jüngsten Anhörungen im Parlament kamen Opfer von geschlechtsspezifischen Deepfakes und KI-Unternehmer zusammen – ein Beweis dafür, dass auch ohne Gesetzgebung der politische Wille wächst, sich mit den Schattenseiten der KI auseinanderzusetzen. Was diese vereinzelten Bemühungen verbindet, ist eine einzige Idee: Lateinamerika kann es sich nicht leisten, dass Außenstehende darüber entscheiden, wie Fairness in Sprachen und Arbeitsmärkten aussieht, in denen sie noch nie einen Fuß gesetzt haben.
Ein regionaler Entwurf, ein Prinzip nach dem anderen
Um eine Fragmentierung zu vermeiden und sinnvolle Standards zu schaffen, braucht die Region laut Experten keinen Entwurf, sondern einen Kompass. Die Analysten Ángeles Cortesi und Pablo León haben vier Fragen formuliert, die als Leitlinien für alle KI-Gesetzesentwürfe in der Region dienen sollten:
Was ist der Zweck? Geht es darum, Investitionen anzuziehen, die Privatsphäre zu schützen oder die staatliche Kontrolle zu stärken?
Wo liegt das Risiko? Sollten KI-Systeme an Grenzen oder Kreditalgorithmen strenger kontrolliert werden als Lieferdrohnen?
Welche Art von Regeln? Sollten Gesetzgeber ethische Grundsätze, technische Spezifikationen oder flexible Sandkästen festlegen?
Wie passt das zur Region? Kann ein Gesetz an Orten Bestand haben, an denen die Hälfte der Arbeitskräfte informell beschäftigt ist und die Internetgeschwindigkeit 30 Minuten außerhalb der Hauptstadt zusammenbricht?
Das sind keine rhetorischen Fragen. Lateinamerikanische Entwickler berichten, dass beliebte, auf Englisch trainierte Chatbots häufig indigene Namen verhunzen und zusammengesetzte spanische Verben nicht verstehen. Aus Asien importierte Bewertungssysteme für die Gig Economy stufen Arbeitnehmer mit mehreren Einkommensquellen regelmäßig als Betrüger ein, weil die Algorithmen nicht für komplexe informelle Volkswirtschaften entwickelt wurden. Die Lösung? Lateinamerikanische Vorschriften, die vielfältige Trainingsdatensätze vorschreiben, mehrsprachige Erklärbarkeit verlangen und staatliche Datenpools öffnen, damit lokale Start-ups nicht selbst recherchieren oder raten müssen.
Von isolierten Gesetzesentwürfen zu einer lateinamerikanischen KI-Doktrin
Fragmentierung ist eine Gefahr. Wenn Uruguay lockere Regeln schafft, während Mexiko-Stadt streng durchgreift, werden KI-Unternehmen sich einfach in Montevideo niederlassen und von dort aus überall operieren. Das ist der älteste Trick im Spielbuch. Um diese Entwicklung zu stoppen, hat die von den Vereinten Nationen unterstützte Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik eingeschritten. Ihre Digitale Agenda für 2024 schlägt einen kontinentweiten Ansatz für die KI-Aufsicht vor, der Folgendes umfasst:
Ein gemeinsames „KI-Aufsichtslabor” an führenden Universitäten
Eine regionale Sandbox für Fintech-Start-ups, die gemeinsam von Regulierungsbehörden aus drei Ländern überwacht wird
Ein standardisiertes Stresstest-Protokoll für die Prüfung großer KI-Modelle
Diese Vision könnte Lateinamerika dabei helfen, mit Hyperscalern zu verhandeln und gerechtere Cloud-Speicher-Vereinbarungen oder einen Zugang zu Halbleitern durchzusetzen. Aber Visionen brauchen Geld. Die meisten regionalen Behörden verfügen nicht einmal über einen einzigen Vollzeit-Datenwissenschaftler. Befürworter schlagen nun eine einfache Lösung vor: einen Teil der Einnahmen aus Frequenzauktionen für die Finanzierung von KI-Kompetenzprogrammen nach dem Vorbild der estnischen E-Governance-Bootcamps vorzusehen. Es geht nicht darum, mit den Tech-Giganten gleichzuziehen. Es geht darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, damit Lateinamerika für sich selbst sprechen – und programmieren – kann.
Der Countdown für eine souveräne KI-Strategie
Die nächsten 18 Monate sind entscheidend. Sobald Europa sein Gesetz zur Entwicklung von Cloud- und KI-Technologien verabschiedet hat und Washington seine Investitionen in die KI-Forschung und -Entwicklung verdoppelt, werden globale Unternehmen ihre Compliance-Budgets an die erste Instanz anpassen, die Regeln festlegt. Aber Lateinamerika hat noch Zeit. Wenn es schnell handelt, könnte es Investoren regulatorische Klarheit ohne Rigidität bieten – einen Rahmen, der streng gegen den Missbrauch biometrischer Daten vorgeht, aber Klimatechnologie und KI in der Landwirtschaft nur geringfügig einschränkt. Eine solche Positionierung könnte Kapital anziehen und Vertrauen schaffen, insbesondere an Orten, an denen Empfehlungsalgorithmen bereits alles von der Bildung bis zum Wohnungswesen bestimmen.
Und die Öffentlichkeit schaut zu. Derzeit haben Bürger keine sinnvollen Rechtsmittel, wenn ein Einstellungsalgorithmus sie als unqualifiziert einstuft oder wenn eine Bank ihnen aufgrund fehlerhafter KI-Berechnungen einen Kredit verweigert. Transparenz, lokalisierte Ethik und häufige Aktualisierungen – nicht statische Regeln – könnten das Rückgrat der lateinamerikanischen KI-Identität bilden. Die Chance ist da: die Technologie zu gestalten, bevor sie die Region gestaltet. Und in einer digitalen Welt, die selten wartet, haben die Gesetzgeber der Region möglicherweise nur eine Chance, ihren Namen unter den Kodex zu setzen.


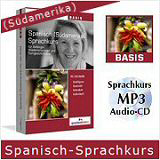







































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!