Rassistische und homophobe Gesänge entstehen nicht in Stadien – sie werden im Alltag einstudiert. Solange die lateinamerikanischen Fußballverbände nicht über den Tellerrand hinausblicken und sich mit den tieferen sozialen Kräften hinter dem Verhalten der Zuschauer auseinandersetzen, werden Geldstrafen und Verbote weiterhin ihr eigentliches Ziel verfehlen. Vierzigtausend Stimmen im Einklang können ein Stadion wie eine eigene Nation wirken lassen. Aber wenn diese Stimmen hässlich werden – zu rassistischen Spottrufen oder homophoben Gesängen –, bleibt die Lösung meist begrenzt: Geldstrafen, teilweise Schließungen, Kapazitätsbeschränkungen. Die Logik dahinter? Es ist ein Fußballproblem, also löst es mit fußballerischen Mitteln. Doch diese Sichtweise ist zu eng. Die Grundlagen der Fußballsoziologie – von Norbert Elias‘ Zivilisationsprozessen bis zu Pierre Bourdieus Feldern symbolischer Macht – halfen Wissenschaftlern, Stadien als Rituale der Identität, Männlichkeit und Bedeutung zu verstehen. In Lateinamerika zeigten Autoren wie Eduardo Archetti und Pablo Alabarces, wie Fußball mit Nationenbildung, Männlichkeit und Mythos verschmilzt.
Aber es gibt einen blinden Fleck: die Vorstellung, dass das Stadion der Mittelpunkt ist. Diese Annahme trifft nicht mehr zu. In Städten in der gesamten Region entstehen die Gesänge, die man an Spieltagen hört, nicht auf den Tribünen – sie sind Echos von WhatsApp-Chats, Schulhofwitzen, politischen Kundgebungen und algorithmisch angeheizter Wut. Barras bravas, diese eng verbundenen Fangruppen, leben nicht losgelöst von Machtstrukturen. Wie Wissenschaftler wie José Garriga Zucal gezeigt haben, sind sie oft in politische Maschinerien, klientelistische Netzwerke und den Polizeiapparat selbst eingebettet. Hassgesänge als Problem des Fanverhaltens zu behandeln, bedeutet, das Symptom zu bekämpfen, nicht die Ursache.
Stadionsprechchöre sind Symptome, keine Ursachen
Die Strafen der FIFA sind real – aber sie zielen auf die falsche Ebene ab. Die Theorie der sozialen Identität besagt, dass Sprechchöre nicht nur Vorurteile widerspiegeln, sondern auch Zusammenhalt schaffen, indem sie in Momenten hoher Emotionalität die Gruppe zusammenhalten. Und in Lateinamerika werden diese Grenzen – in Bezug auf Rasse, Geschlecht, Sexualität – lange vor dem Drehkreuz geprägt. Der berüchtigte mexikanische „Grito“, der gegnerischen Torhütern entgegen geschleudert wird, hat sich zwei Jahrzehnte lang gegen Kampagnen und Geldstrafen behauptet. Warum? Weil, wie Wissenschaftler wie Brenda Elsey und Joshua Nadel zeigen, lateinamerikanische Männlichkeit durch Demütigung, Anspielungen und „Picardía“ – das Augenzwinkern hinter der Ohrfeige – geprägt ist. Dieser Gesang ist Teil einer kulturellen Grammatik, nicht nur eine Provokation.
Und jetzt verbreitet sich diese Grenzüberschreitung. Durch TikTok, Telegram und Meme-Seiten wird das abweichende Verhalten der Menge zu Einfluss. Plattformen belohnen es. Der Gesang ist nicht mehr nur ein Moment – er ist Inhalt. Mittlerweile besteht die Menge nicht mehr nur aus Fans. Es ist ein Kreislauf aus analogen und digitalen Darbietungen, in dem das Singen eines Schimpfwortes zwar zu einem Stadionverbot führen kann – aber online viral geht. In dieser Wirtschaft werden Geldstrafen zu Hintergrundgeräuschen. Und der Hass singt weiter.
Was ein breiterer Blickwinkel offenbart
Wenn man das Stadion verlässt, sieht man die Mechanismen. Erstens gibt es institutionelle Komplizenschaft. In Ländern wie Argentinien und Kolumbien haben Studien gezeigt, wie Fangruppen Vergünstigungen – Tickets, Reisen, Arbeitsplätze – im Austausch für politische Loyalität, Mobilisierung oder Disziplin auf den Tribünen erhalten. Ein Hassgesang ist in diesem Zusammenhang nicht nur eine Reaktion der Menge, sondern ein Signal. Zweitens bleibt das Stadion einer der wenigen Orte, an denen Jugendliche aus der Arbeiterklasse sichtbar sind. In Städten, die von Ungleichheit und übermäßiger Polizeigewalt geprägt sind, sind Gesänge von den Tribünen eine Form der Präsenz. Der Staat mag dich auf der Straße marginalisieren – aber nicht in der Curva. Diese Sichtbarkeit bringt Stolz mit sich – und Risiken. Drittens sind diese Gesänge oft rassistisch geprägte Ausdrucksformen des Nationalismus. In Argentinien dominiert nach wie vor die weiße Hautfarbe das nationale Ideal. In Brasilien verschleiert der Mythos der Rassendemokratie tiefere Muster der Ausgrenzung von Schwarzen. Wenn also ein Spieler afrikanischer Herkunft verspottet wird, ist der Hass nicht zufällig – er ist Teil einer nationalen Geschichte darüber, wer dazugehört.
Und doch ist das Stadion auch ein Ort des Widerstands und der Neuerfindung. Der Aufstieg von LGBTQ+-Barras, Frauenkollektiven und antirassistischen Fanclubs zeigt, dass Fußball nicht statisch ist. Diese Gruppen hinterfragen die Normen, schreiben die Gesänge um und gestalten das Ritual neu – wenn ihnen dafür Raum und Sicherheit gegeben wird. Eine eng gefasste Soziologie, die sich nur auf Hooligans konzentriert, übersieht dies.
Anreize schaffen, nicht nur Gesänge
Was funktioniert also tatsächlich? Beginnen Sie mit Anreizen. Binden Sie einen Teil der Einnahmen des Vereins oder der Turnierauszahlungen an messbare Fortschritte, wie unabhängige Audits von diskriminierenden Vorfällen, Steward-Schulungen, lokale Partnerschaften und Inklusionskennzahlen. Machen Sie Zugehörigkeit zu einer Geldfrage – und Ausgrenzung zu einem finanziellen Risiko. Als Nächstes unterbrechen Sie die Patronage-Pipelines. Das bedeutet transparente Ticketvergabe, Verbot politischer Einmischung in die Fanlogistik und Ersatz von Schattennetzwerken durch sichtbare, rechenschaftspflichtige Systeme. Die Kriminologie legt nahe, dass gezielte Abschreckung am besten funktioniert: Konzentrieren Sie sich auf die Rädelsführer, nicht auf die Massen; bieten Sie denjenigen, die bereit sind, der Gewalt den Rücken zu kehren, einen Ausweg in die reguläre Arbeitswelt. Dann zähmen Sie die digitale Echokammer. Fordern Sie Plattform-Reibung an Spieltagen – Verzögerungen beim Hochladen, automatische Kennzeichnung von Beleidigungen in lokalen Dialekten, KI-geschulte Moderation, die regionale Signale versteht. Eine Verlangsamung der Viralitätskurve kann performativem Hass die Luft nehmen.
Und schließlich sollte in langfristige, von Lateinamerika geleitete Forschung investiert werden. Hier wird zu viel Fußballsoziologie aus Europa angewendet. Finanzieren Sie Studien, die den Gesängen von der Nachbarschaft bis zum Hashtag, vom Schulhof bis zum Liederbuch folgen. Kombinieren Sie Ethnografie mit Netzwerkanalyse und hören Sie nicht nur den Ultras zu. Geben Sie den Gegenkulturen, die bereits das Drehbuch umschreiben, eine Plattform. Den inklusiven Kollektiven, den Müttergruppen, den queeren Fankurven. Beziehen Sie sie in die Verwaltung ein. Lassen Sie sie Kampagnen, die in ihrem Namen durchgeführt werden, ablehnen. Zeigen Sie sie in Sendungen. Finanzieren Sie ihre Banner, nicht als PR, sondern als Politik. Fußball ist nicht von der Gesellschaft getrennt. Und die Gesellschaft wird sich nicht ändern, wenn man die Stadionkapazität für ein Spiel halbiert. Der Gesang hört auf, wenn sich das Drehbuch ändert. Und dieses Drehbuch wird lange vor dem Anpfiff geschrieben.


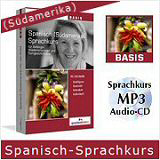






































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!