Mexico, Kolumbien, Venezuela oder Brasilien – viele lateinamerikanische Staaten haben ein ernsthaftes Kriminalitätsproblem. Doch in keinem hat die Kriminalität in den letzten Jahren solche Ausmaße erreicht, wie im Länderdreieck von Guatemala, El Salvador und Honduras. In Guatemala-Stadt stellt selbst eine einfache Busfahrt eine Mutprobe dar, seit es in diesen fahrenden Schrottkisten fast jeden Tag zu Schießereien mit Toten und Verletzten kommt. Meistens trifft es Passagiere, die sich einem der täglich dutzenden von Raubüberfallen widersetzen, oder die dem Räuber nicht schnell genug die Geldbörse aushändigen. Oft sind es auch die Fahrer und Bushelfer, die den üblichen Schutzgeldzahlungen nicht nachgekommen sind. In vielen Bussen fahren nun bewaffnete, private Polizisten mit. Und selbst im eigenen Auto kann man sich schon lange nicht mehr sicher fühlen. Ganze Banden auf Motorrädern haben sich darauf spezialisiert, ihre Opfer vor roten Ampeln einzukreisen, den Fahrer durch die Scheiben mit Pistolen zu bedrohen und die Herausgabe von Geld und Handy zu fordern. Fußgänger bewegen sich wie in einem Kriegsgebiet, stets darauf bedacht, wer hinter ihnen läuft oder wer ihnen entgegenkommt.

Nach acht Uhr wagten sich nur noch wenige auf die Straße; Freizeitaktivitäten finden größtenteils in Einkaufszentren statt. Nach offiziellen Statistiken kamen allein im Jahr 2011 bisher über 6000 Menschen durch Kapitalverbrechen ums Leben, wovon etwa zehn Prozent weiblich waren. Viele dieser Frauen wurden auf äußerst grausame Art und Weise ermordet. Immer wieder tauchen Leichenteile auf, irgendwo abgestellt in Plastiksäcken oder verstreut an öffentlichen Orten. Es geht ganz klar darum, Panik zu verbreiten. Wer steckt diesen abscheulichen Verbrechen? Sind es Drogenkartelle, Jugendbanden oder gewöhnliche Psychopaten? Es ist wohl ein Gemisch von alldem. Guatemala kommt bei einer Einwohnerzahl von vierzehn Millionen auf über 50 Morde pro 100.000 Einwohnern im Jahr. In den meisten Staaten Europas liegt dieser Wert unter eins. Und selbst in einem ähnlich geschichteten Land wie Bolivien, liegt die Mordrate um ein vielfaches niedriger. Eine entscheidende Mitschuld trägt das chronisch korrupte Justizwesen, welches in weniger als zwei Prozent aller Fälle fähig ist, die oder den Täter zu ermitteln oder gar einer Verurteilung zuzuführen.
Philip Alston, Sonderberichterstatter der UNO für außergerichtliche Hinrichtungen, bezeichnete Guatemala vor einiger Zeit in einem Bericht als „ein ideales Land, um einen Mord zu begehen“. Es überrascht daher auch wenig, dass sogenannte Lynchjustiz ein zunehmendes Problem darstellt, speziell in ländlichen Gebieten. Dutzende von vermeintlichen Übeltätern werden jedes Jahr von wütenden Mobs mit Benzin übergossen und angezündet. Oft genügt ein Bagatelldelikt, etwa der Diebstahl einer Kuh, um so zu enden. Diese Lynchmorde haben sich in den letzten sieben Jahren verfünffacht, wie die guatemaltekische Ombudsstelle für Menschenrechte in einem Bericht feststellt. Von 25 im Jahr 2004 auf 147 im laufenden Jahr.
Um den Ursachen dieser barbarischen Zustände auf den Grund zu gehen, hilft ein Blick auf die von tiefsten sozialen, kulturellen und ethnischen Gegensätzen charakterisierte Geschichte dieses Landes, in dem über Jahrhunderte ein Apartheid-Regime funktionierte. An dessen Spitze stand eine überwiegend spanischstämmige Oberschicht, welche mit eiserner Faust über eine Mehrheit aus Maya-Volksgruppen herrschte, denen aus machtpolitischem Kalkül jegliche eigenständige Entwicklung verwehrt blieb. Zur Fundierung und Aufrechterhaltung ihres Herrschaftsanspruches praktizierte diese Elite eine Politik des offenen Rassismus, gepaart mit brutaler Gewaltanwendung. Über lange Zeit wurden die Indios als nicht zivilisierbar angesehen und mussten als Ursache für die Rückständigkeit des Landes herhalten. Präsident Justo Rufino Barrios wollte gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts die Einwanderung von Europäern fördern, um so eine vermeintliche „rassische Aufbesserung“ zu erreichen. Noch 1944, unter dem Diktator und Nazibewunderer General Jorge Ubico, wurde die indianische Bevölkerung per Gesetz verpflichtet, praktisch unentgeltlich auf den Zuckerrohr-Plantagen und Kaffeefarmen weißer Großgrundbesitzer zu schuften. Wer nicht parierte oder aufbegehrte, riskierte standrechtlich erschossen werden.
„Sei doch kein Indio!“ ist ein noch heute gern gebrauchter Ausdruck vieler mestizischer Eltern, mit dem sie ihre Kinder maßregeln. Immer noch kontrollieren zwei Prozent der Bevölkerung fast 70 Prozent des kultivierten Bodens. Guatemala ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt, doch 96 Prozent der Bauern müssen sich mit nur 20 Prozent der bebauten Fläche begnügen, wobei es sich zumeist um weit abgelegene, beinahe unfruchtbare oder gebirgige Schollen handelt.
Aber können diese tristen Realitäten und ihre geschichtlichen Wurzeln allein als Erklärungsmuster für das aktuelle, eklatante Gewaltniveau herhalten? Einen entscheidenden Teil der Antwort finden wir im Bürgerkrieg, der von 1960 bis 1996 ausgetragenen wurde und Guatemala entscheidend geprägt hat. In diesem bekämpften marxistische Guerillagruppen den meist von autoritären Armee-Generälen geführten Staat mit Waffengewalt. Nach verschiedenen Schätzungen sollen dabei an die 150.000 Menschen ihre Leben verloren haben. Auf dem Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen, in den Jahren 1980-83, zerstörte die Armee über 200 indianische Dörfer und massakrierte systematisch Zehntausende von Maya-Indianern. Aber auch die linksgerichteten Aufständischen trugen zu den eklatanten Menschenrechtsverletzungen bei. All dies führte zu einer weiteren Schwächung der staatlichen Institutionen und förderte eine allgemeine Brutalisierung der Gesellschaftsformen. Die Demokratisierung durch relativ freie Wahlen im Jahr 1985 diente als Sprungbrett für eine korrupte und populistische Politikerklasse, die bisher eher daran interessiert war, sich zu bereichern, als sich um die Lösung der dringenden sozialen Probleme zu bemühen.





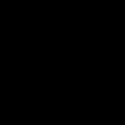

































 © 2009 – 2025 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2025 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!