 Heute vor zwei Monaten geschah das Grässliche. Innert Sekunden starben 300’000 Menschen unter den Trümmern ihrer Häuser, 300’000 wurden verletzt und 1,2 Millionen Häuser krachten zusammen. Meines war auch darunter. Ich verlor alles, aber auch alles, was ich besessen hatte, alles lag unter dem Schutt. Aber ich lebe noch, dank einem gütigen Schicksal, oder einer gütigen Hand.
Heute vor zwei Monaten geschah das Grässliche. Innert Sekunden starben 300’000 Menschen unter den Trümmern ihrer Häuser, 300’000 wurden verletzt und 1,2 Millionen Häuser krachten zusammen. Meines war auch darunter. Ich verlor alles, aber auch alles, was ich besessen hatte, alles lag unter dem Schutt. Aber ich lebe noch, dank einem gütigen Schicksal, oder einer gütigen Hand.
Wir haben überlebt, zuerst in einer Gruppe von hunderten von Flüchtlingen, Überlebenden aus weiter Nachbarschaft. Auf der obersten freien Fläche der Schwarzen Berge (Montagnes Noires), eigentlich einem Bauplatz. Tagsüber tauchten die Männer ab, um nach Häusern und Vermissten zu sehen, Tote und Verletzte zu suchen und zu bergen, oder um die Nester auszubauen, etwa mit einem gespannten Tuch gegen Regen zu schützen. Andere gründeten ein „Komitee“ und nahmen Namenlisten auf, um eine Art „Einwohnerkontrolle“ zu gewinnen und diese an UNO oder Hilfsorganisationen weiter zu leiten.
Schon am Tag nach dem Erstbeben wimmerte ein Handy eine vorlaute Tonfolge, es wirkte ironisch in dieser Umgebung und war trotzdem ein Lichtstrahl im Dunkel, denn auch Strom erlebten wir natürlich nie mehr, übrigens für Tage das einzige Telefonat das ankam. Wie das die Botschaft geschaffen hat, bleibt ihr Geheimnis und grenzt an ein Wunder. Sie haben sich nach meinem Befinden erkundigt und wären mich sofort holen gekommen, wenn mir etwas zugestoßen wäre. Von meinem verschwundenen Haus, Hab und Gut wusste ich allerdings noch nichts, das war auch nicht wichtig in dieser Phase.
Vor der zweiten Nacht wechselten wir den Schlafplatz, wenig tiefer, und richteten uns hinter dem Haus von Melissa und anderen Nachbarn einigermaßen ein, mit Tüchern über dem Kopf. Die Gruppe reduzierte sich auf Familienangehörige meiner Pflegerin und eine Gruppe von Nachbarn, die sich vorher kaum gekannt und gegrüßt hatten. Alle teilten das gleiche Schicksal, und alle teilten auch alles Übrige. Ich scharrte mir eine einigermaßen körperfreundliche Liegestatt zu Recht, mit Hüft- Becken- und andern Knochenlöchern und so konnte ich nun doch etwas schlafen. Aber die Härte blieb, und das nächtliche Umdrehen bewirkte wunde, schmerzende Stellen.
Ich sollte eigentlich aus früheren Zeiten Schlafen auf hartem Boden gewohnt sein, auf nasskaltem Fels in unterirdischen Höhlen, auf kaum abgedecktem Gletschereis im Hochgebirge und anderes mehr. Aber bald in den Achtzigern ist man zu „gstabig“ für solche Jugendscherze. Melissa beschaffte irgendwo ein eisernes Klappbett, das sie für mich aufklappen wollte – mitten im Nest. Dabei klemmte sie sich unglücklicherweise fast einen Finger ab, er hing nur noch knapp von der linken Hand und verursachte unsägliche Schmerzen. An einen Arzt oder gar ein Spital war nicht zu denken, die waren weit weg, die Spitäler dem Hörensagen nach sogar eingestürzt. Ihre Schwester Majorie hatte in der Nähe gewohnt und war dem Vernehmen nach unter eine einstürzende Mauer geraten. Sie war schwer verletzt und lag drei Tage lang zuunterst in der Schlucht, ihr Transport hinauf in unser Nest gelang erst nach Tagen, aber wir konnten ihr auch nicht helfen. Ich war dank dem weichen Bett wenigstens fähig etwas zu schlafen. Infolge der allnächtlichen Schießereien war dies allerdings ein Kunststück; es seien mehr als 6000 Schwerverbrecher aus den zerstörten Gefängnissen ausgebrochen und bedienten sich gestohlener Waffen. Spannung und Angst waren unerträglich.

Am dritten Tag erspähten wir unten, wo das fahrbare Bergsträsschen endet, ein Fahrzeug der UN, das langsam per Vierradantrieb herauf kroch und am Kehrplatz anhielt. Offenbar waren die schlimmsten Hindernisse beiseite geräumt, und die Trasse war wieder einigermaßen benützbar. Erwartungsvoll stieg die Jungmannschaft hinunter, und es war nicht vergebens: nach zwei Stunden kehrten sie mit Wasser, Reissäcken, Öl und andern Lebensmitteln zurück, und das Kochen auf Holzkohle waren sie – leider – gewohnt. Dasselbe wiederholte sich drei Tage später nochmals, und ich muss sagen, Hunger mussten wir nie leiden. Ganz im Gegensatz zu den später gelesenen Medienmeldungen, die an den Hilfsorganisationen nicht Gutes ließen.
Etwa am vierten Tag konnte ich einen Mitleidenden überreden, sein Motorrad auszugraben und zu versuchen, zu meinem Haus in Gressier vorzudringen. In Gesichtsmasken und zu zweit schafften sie die Fahrt, vorbei an Mauern von Kadavern und sich zwischen klaffenden Spalten durchschlängelnd. Was sie berichteten, war unbeschreiblich, und ich brauchte da nicht auch noch hinzugehen. Später schaute ich nach in Google-Earth. Die Satellitenaufnahmen waren taufrisch und so klar, dass auch alles andere klar war…
Der neunte Tag war vorübergeschlichen. Ich drängte auf einen Kontakt mit der Botschaft. Das war nur zu Fuß und per Motorrad möglich; mit einem Begleiter suchten wir den Standort. Das Haus stand zwischen Stützen und war rissig, und wegen Einsturzgefahr ließen die Sicherheitsmenschen Besucher nur einzeln eintreten. Die Botschaftsmitarbeiter aber arbeiteten im Innern voll oder wohl doppelt, die Gesichter waren von Angst und Spannung gezeichnet. Jeden Tag seien Evakuationsbusse nach Santo Domingo unterwegs; im Schutze der dortigen Schweizer Botschaft sei dann einmal Warten angesagt.
Die Busse waren ausgebucht, und wir bekamen erst am folgenden Tag, dem zehnten, einen Platz. Nicht mehr so rüstig wie auch schon, bat ich darum, meine haitianische Pflegerin aus medizinischen Gründen mitnehmen zu dürfen. Nach einem Telefon mit dem Botschafter in Santo Domingo wurde mir ein Visum für sie versprochen, natürlich garantierte ich ihre Rückkehr, und was man so sonst noch garantieren muss.
Heute wollte sie eigentlich zurückreisen zu ihren vier Kindern und ihrem Mann, und heute laufen Flugtickets und Versicherung ab. Das Visum ist zwar noch zwei Monate gültig, aber in einem gestohlenen Pass nützt das auch nichts. Warum ich jetzt unfreiwillig wortbrüchig bin und die Arme für sehr lange papierlos in Frankreich gefangen bleibt, habe ich bereits beschrieben. Es war der zehnte Tag. Heute wurde die Suche nach Überlebenden eingestellt. Wir fanden uns nachmittags beim Rettungsbus ein. Endlich, weg von den nächtlichen Todesschützen und Mördern ! Ich wartete mit anderen Schweizer Opfern und meiner rechten Hand ( die linke war verletzt ) auf die Evakuation nach Santo Domingo. Nette Helfer stellten sich vor, die extra aus der Schweiz gekommen waren, um uns zu begleiten und zu helfen. Noch im Hotel in der dominikanischen Hauptstadt betreuten sie uns zwei Tage lang; die Botschaften hatten alles getan!
„Im letzten Moment kamen noch zwei Helferinnen in Montur des Humanitären Hilfswerks der DEZA ( Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, ich zitiere mich selbst ), dessen Aufgabe es ist, „Leben zu retten und Leiden zu lindern“. Sie trugen sauber gewaschene Babies in den Armen, die mit großen, verängstigten Kolleraugen ins Scheinwerferlicht lugten und darum bebten, was mit ihnen geschehe. Aber es war wohl nur Gutes, die Babies hatten Glück, in den Armen der ausgebildeten Helferinnen, in Santo Domingo und schließlich in den Armen der Schweiz zu landen, wo ihnen wohl Geburtsurkunden, neue Namen, Papiere und eine Schweizer Bürgerschaft verpasst wurden. Unzählige Babies (und auch Non-Babies) hatten weniger Glück, sie wurden in den Trümmern noch nach Wochen lebend und nur zufällig, die meisten aber überhaupt nicht gefunden und starben einen grässlichen, qualvollen Tod.“
Dann ging es los, die Fahrt war mühsam und schrecklich, die Straßen hoffnungslos verstopft. Im dämmerigen Zwielicht ging es an tausenden von Einsturzruinen vorbei, Bilder wie im Krieg nach einem Bombardement. Wir passierten die Grenze einmal ohne Anhalt, Kontrollen gab es nirgends. Spätnachts wurden wir in Santo Domingo in Hotels verteilt und noch einige zeit von der dortigen Botschaft betreut. Jeden Tag trafen aus Haiti neue Flüchtlinge ein, die Hotels aber waren völlig ausgebucht, die Plätze in Flugzeugen auch. Einen Monat nach dem Inferno erhielten wir Plätze nach Europa.
PS. Meine ID-Karte ist bis heute, dem 11.März, noch nicht eingetroffen, wie versprochen…





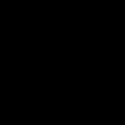

































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!