Das bolivianische Städtchen Charobamba liegt im Nebelwald, fast 1.700 Meter hoch in den Anden. In dieser einsamen Berglandschaft siedelten sich Anfang der 40er-Jahre aus Deutschland und Österreich stammende jüdische Flüchtlinge an, um eine landwirtschaftliche Kooperative zu gründen. Nach dem Krieg verließen viele wieder das Land. Heute erinnert nur noch wenig an die jüdischen Kommunarden.
Mitte Januar wurde der Gründergeneration nun in einem jüdischen Museum ein Denkmal gesetzt. „Ich möchte dem Staat und der Bevölkerung Boliviens meinen tiefen Dank aussprechen, dass sie durch ihre Gastfreundschaft vielen jüdischen Bürgern das Leben gerettet haben“, sagte der deutsche Botschafter in Bolivien, Peter Linder, bei der Einweihung. Mit einer Finanzspritze von 15.000 Euro hat die Botschaft die Errichtung des Museums ermöglicht.
Seit Jahren unterstützt Deutschland in der Region entwicklungspolitische Projekte zur Stabilisierung der Umwelt. Man habe nicht nur eine Gegend bewahren, sondern auch an jene jüdischen Kolonisatoren erinnern wollen, die dort damals von der bolivianischen Regierung zum Ackerbau angesiedelt worden seien, begründete Linder das Engagement der deutschen Botschaft in der Andenrepublik. Mit der jüdischen Gemeinde des Landes bestehe seit Jahren ein enges Verhältnis. Immer wieder gebe es „gemeinsame Veranstaltungen, vor allem im Zusammenhang mit der Erinnerungskultur“.2
Als eine kleine Dorfschule renoviert wurde, ergab sich der Platz, um in deren Obergeschoss drei Museumsräume einzurichten, um die Geschichte der Kibbuzim und deren Alltag zu dokumentieren. Eine zweite Abteilung des Museums ist den jüngeren Generationen jüdischer Bolivianer gewidmet.
„Besser spät als nie“, sagte der Vorsitzende des rund 400 Mitglieder umfassenden „Israelitischen Vereins Boliviens“, Ricardo Udler, bei der Eröffnung des Museums. Die Mehrzahl von ihnen lebt in der Hauptstadt La Paz, in der es eine Synagoge gibt. Auch die etwa 70 Beter der Gemeinde in der Provinzhauptstadt Cochabamba verfügen über ein Gotteshaus. Ohne Bethaus treffen sich die 180 Gemeindemitglieder von Santa Cruz in Privathäusern zum Gebet. „Wir alle stehen in engem Kontakt“, betonte Udler in seiner Rede. „Der einzige Unterschied zwischen uns ist die religiöse Ausrichtung“.
Mit freundlicher Genehmigung der „Jüdische Allgemeine“





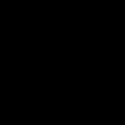

































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!