Elon Musk beschuldigt Donald Trump, in den Skandal um Jeffrey Epstein verwickelt zu sein. Trump droht mit der Kündigung milliardenschwerer Verträge mit SpaceX usw. Die Episode und ihre Auswirkungen gleichen dem Drehbuch einer politischen Reality-Show – und vielleicht ist es das auch. Aber sie dient als Warnung: Wenn die Wirtschaftsmacht sich als Herrscher über die öffentliche Macht fühlt, ist das Gemeinwohl das Erste, was auf der Strecke bleibt. In Brasilien folgen Allianzen zwischen Regierungen und Großvermögen derselben Logik. Der Unterschied ist, dass sie hier selten Skandale verursachen. Sie sind zur Normalität geworden. Der Streit zwischen Trump und Musk ist nur ein Schlüssel zum Verständnis. Was er offenbart, erleben wir jeden Tag: die Unterwerfung des Staates unter konzentrierte Unternehmensinteressen. Die Bevölkerung, insbesondere die Ärmsten, zahlt die Zeche – in Form von Ungleichheit, schlechten öffentlichen Dienstleistungen und fehlender Steuergerechtigkeit.
Brasilien lebt seit Jahrzehnten nach der Logik des Patrimonialismus und des Physiologismus. Die Kosten dafür sind sozialer, institutioneller und ethischer Natur. Emblematische Fälle helfen zu verstehen, wie die größte Volkswitschaft in Lateinamerika hierher gekommen ist. In den 1990er Jahren enthüllte der Skandal um die „Budgetzwerge” die Verwendung von parlamentarischen Änderungsanträgen, um öffentliche Gelder durch Scheinprojekte und Scheinorganisationen zu veruntreuen. Im Jahr 2006 zeigte der Fall der „Sanguessugas” (Blutsauger), wie Bundesmittel für Krankenwagen durch zwielichtige Verhandlungen zwischen Unternehmern und Kongressabgeordneten verteilt wurden. Anstatt zu verschwinden, hat sich diese Praxis weiterentwickelt. In jüngerer Zeit ermöglichte der sogenannte „geheime Haushalt” die Verteilung von Milliardenbeträgen ohne öffentliche Kriterien, wodurch Abgeordnete begünstigt wurden, die mit der Exekutive auf einer Linie lagen. Oft landeten die Mittel in den Händen von Unternehmen mit politischen Verbindungen zu Stadtverwaltungen und Bundesstaaten. Technische Kriterien wurden durch informelle Vereinbarungen aus Gründen der Zweckmäßigkeit ersetzt.
Ein weiterer Mechanismus sind Steuervergünstigungen für große Unternehmen. In Bundesstaaten wie Goiás, Amazonas oder Mato Grosso do Sul garantieren Industrieförderprogramme Steuerbefreiungen in Milliardenhöhe ohne klar definierte Gegenleistungen. Nach Angaben der Bundessteuerbehörde werden die brasilianischen Bundesstaaten im Jahr 2025 aufgrund dieser Steuererleichterungen mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Steuereinnahmen verlieren. Dieses Geld könnte Schulen, Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Sozialprogramme finanzieren. Auf Bundesebene zeigt die regulatorische Vereinnahmung ebenfalls, wie die Wirtschaft die Spielregeln bestimmt. Behörden wie ANEEL oder ANTT stehen oft unter dem Druck der Branchen, die sie eigentlich regulieren sollten. Das Ergebnis ist vorhersehbar: Tarife, die nach Belieben gestaltet werden, maßgeschneiderte Ausschreibungen und eine Politik, die bestimmte Gruppen begünstigt. Die Regulierung der Lobbyarbeit gehört zu den Lösungen. Diese Praktiken offenbaren etwas Größeres: Der brasilianische Staat funktioniert in vielerlei Hinsicht wie ein Räderwerk zur Umverteilung von Privilegien. Anstatt Rechte zu garantieren und Ungleichheiten abzubauen, dient der öffentliche Apparat als Instrument zur Aufrechterhaltung von Ungleichheit.
Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, sind Maßnahmen an drei Fronten erforderlich. Erstens: vollständige Transparenz. Änderungen, Anreize und Verträge müssen in Echtzeit zugänglich sein, mit klarer Angabe der Begünstigten und der öffentlichen Ziele für den sozialen Nutzen. Zweitens müssen die Kontrollinstitutionen gestärkt werden. Der Rechnungshof, die Oberste Rechnungsprüfungsbehörde und die Bundesstaatsanwaltschaft müssen sich weniger auf einzelne Skandale konzentrieren, sondern vielmehr auf strukturelle, wiederkehrende und institutionalisierte Veruntreuungen. Drittens muss die Lobbyarbeit formell reguliert werden. Der Zugang von Unternehmen und Wirtschaftsgruppen zur Macht darf nicht weiterhin informell funktionieren. Ein Lobbygesetz mit öffentlicher Registrierung, verbindlichen Terminplänen und Offenlegung von Gesprächen würde die Ungleichheit beim Zugang zum Staat verringern.
Die Nennung der Verantwortlichen erfordert Vorsicht und journalistische Beweise. Das Ziel ist hier nicht die Anklage, sondern die Analyse. Wir wissen bereits, dass das Problem nicht nur einzelne Personen sind, sondern das Modell, das ihnen ein so reibungsloses Agieren ermöglicht. Die Episode zwischen Trump und Musk hat international für Aufsehen gesorgt. In Brasilien werden ähnliche Vorfälle in der Regel stillschweigend beigelegt – oft unter Applaus. Solange wirtschaftliche und politische Eliten öffentliche Prioritäten hinter verschlossenen Türen festlegen, wird der Staat weiterhin seiner grundlegendsten Aufgabe nicht gerecht: der Gesellschaft zu dienen und nicht den Machthabern.


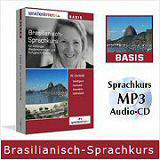








































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!