Ob im Thermobecher auf dem Weg zur Arbeit, in der Nachmittagspause oder als doppelter Espresso nach dem Mittagessen – Kaffee ist aus dem Alltag von Millionen Brasilianern und Milliarden Menschen weltweit kaum mehr wegzudenken. Die Bedeutung des Getränks ist so offensichtlich geworden, dass es sogar in die internationale Diplomatie Einzug gehalten hat: In einem kürzlichen Gespräch zwischen Lula und Donald Trump stand brasilianischer Kaffee auf der Tagesordnung. Laut BBC News Brasil kommentierte der US-Präsident, dass die Vereinigten Staaten die von einem Zollsatz von 50 % betroffenen brasilianischen Produkte „vermissen”, wobei er speziell Kaffee erwähnte. Und diese Abhängigkeit der USA ist keine Übertreibung: Die Vereinigten Staaten produzieren keinen Kaffee in kommerziellem Maßstab und sind auf Importe angewiesen, um eine Nachfrage zu befriedigen, die weltweit täglich Milliarden von Tassen umfasst. Brasilien, der weltweit größte Produzent und für fast die Hälfte des Arabica-Angebots verantwortlich, ist ein zentraler Bestandteil dieser Versorgung.
Aber was erklärt aus wissenschaftlicher Sicht die Tatsache, dass Kaffee so unverzichtbar geworden ist, dass er Grenzen überschreitet, Volkswirtschaften und sogar die Diplomatie beeinflusst? Die Hinweise finden sich im Gehirn und in den neurobiologischen Mechanismen, die Forscher gerade zu entschlüsseln beginnen.
Lust- und Belohnungskreisläufe
In Zahlen ausgedrückt ist das Ausmaß beeindruckend: Weltweit werden täglich fast 2,5 Milliarden Tassen getrunken. Nach Angaben der Internationalen Kaffeeorganisation (ICO) liegt der weltweite Verbrauch bei über 177 Millionen 60-kg-Säcken pro Jahr, was etwa 485.000 Säcken pro Tag entspricht. Allein in den Vereinigten Staaten trinken 66 % der Erwachsenen täglich Kaffee, was laut Daten der National Coffee Association (NCA) einem Anstieg von 7 % seit 2020 entspricht. Und was diesen globalen Appetit vor allem nährt, ist die auf den Alltag angewandte Neurobiologie: eine Kombination aus erlerntem Genuss, anhaltender Wachsamkeit und gesteigerter Konzentration. Die Erklärung beginnt mit einem Schlüsselelement unserer inneren Uhr: Adenosin. Wenn es sich ansammelt, versteht der Körper, dass es Zeit ist, langsamer zu werden. Adenosin ist ein Molekül, das an der Energieproduktion beteiligt ist, indem es Verbindungen wie ATP bildet, die von den Zellen für ihre Aktivitäten genutzt werden. Darüber hinaus wirkt es als chemischer Botenstoff und reguliert Prozesse wie Schlaf, Durchblutung und Gehirnfunktion.
Koffein hingegen ist ein eleganter „Betrüger”. Es hat eine ähnliche Molekülstruktur wie Adenosin und kann sich an die gleichen Rezeptoren binden. Dadurch blockiert es jedoch das Signal der Müdigkeit, ohne die verbrauchte Energie tatsächlich zu ersetzen. Das Ergebnis ist ein falsches Gefühl der Wachsamkeit: Das Gehirn glaubt, dass noch „Treibstoff” vorhanden ist, obwohl in Wirklichkeit nur die Bremse gelöst ist. Dieser biochemische Trick erklärt, warum eine Tasse Kaffee selbst nach einem anstrengenden Tag so wach macht. „Die Verbindung von Koffein mit den Adenosinrezeptoren verbessert unsere Wachsamkeit, weil sie das Signal der Müdigkeit verringert”, erklärt Antonio Herbert Lancha Junior, Doktor der Ernährungswissenschaften und Professor an der Universität von São Paulo (USP). Und genau deshalb können wir länger wach bleiben, aber zu einem Preis: Wenn der Schlaf endlich kommt, hat er nicht mehr die gleiche Qualität. „Man schläft zwar, aber nicht so erholsam wie sonst“, erklärt Lancha Junior.
Studien mit Elektroenzephalogramm (EEG) zeigen, dass Koffein sogar den Rhythmus der Gehirnwellen verändert. Es reduziert das langsamere und entspanntere Muster, das typisch für den Zustand der Schläfrigkeit ist, und fördert einen Zustand erhöhter Wachsamkeit. In der Praxis bedeutet dies, dass das Gehirn aufmerksamer für Reize ist: Das Sehen scheint klarer zu sein, das Denken beschleunigt sich und die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, nimmt zu. Eine in der Zeitschrift „JAMA Network Open” veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass bereits geringe Dosen zwischen 40 und 200 Milligramm Koffein – das entspricht ein bis zwei Tassen Kaffee – ausreichen, um spürbare Effekte zu erzielen. Die Probanden berichteten von weniger Müdigkeit, mehr Energie und reagierten schneller auf Aufgaben, die Aufmerksamkeit und Koordination erforderten. In Langzeittests verbesserte sich auch die Leistungsfähigkeit: Koffein half dabei, die Konzentration über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten, was besonders für diejenigen nützlich ist, die stundenlang lernen, Auto fahren oder arbeiten müssen.
Deshalb haben so viele Menschen das Gefühl, dass sie erst nach dem klassischen Frühstück „richtig funktionieren”. Das Gehirn, das sich noch im Ruhezustand befindet, erhält einen chemischen Schub, der das Ermüdungssystem austrickst und es in den aktiven Modus versetzt. Koffein allein aktiviert jedoch nicht direkt das Belohnungszentrum des Gehirns. Diese Beziehung tritt nur dann auf, wenn der Konsum mit Genuss verbunden ist, beispielsweise wenn eine Person beim Kaffeetrinken Zufriedenheit empfindet. In diesem Fall wird das Vergnügen erlernt und mit der Gewohnheit assoziiert, aber Koffein selbst stimuliert das Belohnungssystem nicht in gleicher Weise wie Substanzen wie Glukose.
Chemischer Reiz oder soziales Ritual?
Jüngste Studien zeigen, dass Kaffee im Gehirn dieselben Lustkreisläufe aktiviert, die auch bei anderen verstärkenden Verhaltensweisen eine Rolle spielen, wie Musik hören, Sport treiben oder etwas essen, das man gerne mag. Diese Aktivierung erfolgt, weil Koffein auf subtile Weise die dopaminergen Bahnen stimuliert, also die Regionen, die für das Wohlbefinden und die Motivation zuständig sind. Die dopaminergen Bahnen sind wie Straßen im Gehirn, die Dopamin transportieren, eine Substanz, die mit Vergnügen, Bewegung und Stimmung in Verbindung steht. Aber was diese Gewohnheit aufrechterhält, geht über die Chemie hinaus. Der Akt des Kaffeetrinkens ist auch ein kontextabhängiges Verhalten. Laut Manuela Dolinsky, Ernährungswissenschaftlerin und Präsidentin des Bundesernährungsrats, hat Kaffee eine symbolische Dimension, die ihn zu einem Teil des sozialen Lebens macht. „Kaffeetrinken ist fast immer ein situatives Verhalten: Es hängt von der Tageszeit, den Arbeitspausen, der sozialen Interaktion, dem Aroma, der Temperatur und sogar dem Klang der Tasse ab”, erklärt sie.
Und diese sensorischen und sozialen Reize schaffen eine angenehme Erfahrung, die das Gehirn mit Momenten der Konzentration, Erholung oder Verbindung zu assoziieren lernt: selbst wenn die Wirkung des Koffeins nicht mehr so stark spürbar ist. Dolinsky betont außerdem, dass Koffein aus neurobiologischer Sicht kleine funktionelle Aktivierungen in den dopaminergen Bahnen fördert, wodurch Leistungserfahrungen angenehmer und verstärkend werden. Dieser Mechanismus schafft wiederum eine Komponente der positiven Verstärkung, die die Wiederholung des Verhaltens begünstigt. „Die Wechselwirkung zwischen Adenosin und Dopamin bewirkt, dass auch die Motivations- und Belohnungskreisläufe moduliert werden, was die Bereitschaft zum Lernen, Arbeiten oder Trainieren unmittelbar nach dem ersten Kaffee erhöht”, fasst er zusammen. „Die Neurochemie erzeugt das Vergnügen an Kaffee und Koffein, aber das soziale Ritual verwandelt die Handlung in eine Routine“, fügt Gustavo Pimentel hinzu, Ernährungswissenschaftler, Mitglied der Brasilianischen Vereinigung für Sporternährung (ABNE) und Doktor der Unicamp.
Pimentel erklärt weiter, dass nicht nur die chemische Seite eine Rolle spielt. Der Geruch, der Geschmack, der Moment der Pause und die Tatsache, dass wir Kaffee oft in Gesellschaft anderer Menschen trinken, aktivieren ebenfalls Teile des Gehirns, die mit guten Erinnerungen und dem Gefühl der Zugehörigkeit verbunden sind. Daher kommt die Gewohnheit, jeden Tag Kaffee zu trinken, sowohl von der Wirkung, die Koffein auf das Gehirn hat, als auch von dem emotionalen und sozialen Wert, den dieses Ritual in unserem Alltag hat. Octavio Marques Pontes Neto, Neurologe und Professor an der USP in Ribeirão Preto, erklärt, dass Kaffee viel mehr als nur ein stimulierendes Getränk ist. „Er enthält Hunderte von bioaktiven Verbindungen und weckt komplexe sensorische Reaktionen: das Aroma, den Geschmack, die Wärme und sogar Erinnerungen, die mit dem Ritual der Zubereitung und des Trinkens verbunden sind”, sagt er. Trotzdem räumt der Forscher ein, dass die Wissenschaft noch weit davon entfernt ist, vollständig zu verstehen, wie diese Elemente miteinander in Verbindung stehen.
Seit Jahrzehnten verbinden epidemiologische Studien den regelmäßigen Kaffeekonsum mit einem geringeren Risiko für Depressionen und Parkinson, möglicherweise aufgrund von Mechanismen, die mit der Wirkung von Koffein auf dopaminerge Neuronen und den antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkungen seiner Verbindungen zusammenhängen. Für diese Zusammenhänge fehlt jedoch noch eine überzeugende kausale Erklärung. Pontes Neto weist außerdem darauf hin, dass es noch keine Studien gibt, die die Wechselwirkung zwischen der pharmakologischen Wirkung von Koffein und den sensorischen und emotionalen Aspekten des Konsums untersuchen. Obwohl das Thema bereits umfassend untersucht wurde, räumt der Forscher ein, dass es noch mehr Fragen als Gewissheiten gibt. „Die Wissenschaft weiß noch wenig darüber, wie diese sensorischen Faktoren mit der pharmakologischen Wirkung von Koffein interagieren”, erklärt er. Seiner Meinung nach erfordert das Verständnis dieser Beziehung eine Trennung zwischen dem, was von der chemischen Verbindung kommt, und dem, was von der sensorischen Erfahrung kommt.


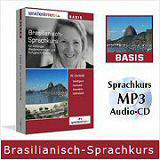







































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!