 Im Hungerland Haiti ist uns vieles unverständlich. Auf den ersten Blick. Für den zweiten Blick haben wir ja nicht nur ZWEI Augen sondern auch ein Köpfchen. Dann verstehen wir vieles. Und beginnen plötzlich zu respektieren, ja zu bewundern, was wir noch eben belachten.
Im Hungerland Haiti ist uns vieles unverständlich. Auf den ersten Blick. Für den zweiten Blick haben wir ja nicht nur ZWEI Augen sondern auch ein Köpfchen. Dann verstehen wir vieles. Und beginnen plötzlich zu respektieren, ja zu bewundern, was wir noch eben belachten.
Ich spreche heute von einigen Ess-Sitten, im Lande des Hungers. Natürlich können solche Sitten nicht beobachtet werden bei den „Bourgois“, der sozialen Oberschicht. Die, wie ich den teuren Wein, Roquefort und anderes nicht missen können (um Irrtümern vorzubeugen, ich zähle mich trotz Zigarren & Co. nicht zu den Bourgois). Von den 8,X Millionen Haitianern gehören ja deren 8 Millionen zur sozialen „Unterschicht“. Da gibt es Ess-Sitten wie geschildert, und Hunger auch.
Das Lambi ist meinen Lesern schon bekannt. Das Lokal ist traditionell und sympathisch, ich bin mit Melissa und Alson jede Woche hier, wohl ein paarmal. Wir sind dann die einzigen zahlenden Gäste, denn die andern, die zuweilen durchaus hier rumhocken, belegen ihre Tische ohne etwas zu bestellen, während Stunden.
Das ist in Haiti durchaus normal und wird geduldet. Niemand kommt fragen, was man gefälligst bestellen wolle, oder fordert einen gar auf zu konsumieren oder das Lokal zu verlassen. Ja gelegentlich packen die Gäste sogar ihren eigenen Lunch aus, was ebenfalls geduldet wird. Man stelle sich das bei uns vor…
Lambi heißt das Hotel und das Speisehaus, Lambi sind auch Muscheln und Meeresfrüchte. Man findet sie auch in der Speisekarte und kann sie im Restaurant bestellen. Die Lambi-Fischer aber machen der Schenke Konkurrenz. Sie rösten die selbstgeernteten Lambi fortwährend auf den Holzkohleherden auf ihren Booten und verkaufen sie, Stacheldraht zu trotz, quasi frisch ab Quelle den Gästen ins Restaurant hinauf. Natürlich für einen Bruchteil des in der Speisekarte verlangten Preises. Auch das wird geduldet. Schließlich kam die Kneipe auf gestohlenen Schienen ja auch auf illegale Weise zustande, und so empfiehlt sich tunlichst auch Großzügigkeit solch wilden Rivalen gegenüber.
Eigentlich wollte ich ein Foto bringen von der üblichen „Verpflegungslogistik“. Mit Kesselitürmen voll warmem Essen. Die Aufnahme gelang mir (noch) nicht. Man muss dafür wohl in einem der überfüllten, öffentlichen Sammeltaxis, den Taptaps, reisen, und diese Erfahrung wiederhole ich lieber nicht mehr.
Da begegnet man um die Mittags- und Nachmittagszeit den Kinderarbeitern, die mit einfachen „Bols“ (Kesseli) unterwegs sind. Darin befindet sich die Nahrung für arme, alte, kranke oder weitab wohnende Familienangehörige, Landarbeiter auf dem Feld oder Handlanger auf einer Baustelle. Kochkisten- oder Gamellen-Verpflegung, würde man im Militär sagen: für einfache Mahlzeiten eine nahrhafte Eintopfsuppe mit Bohnen und Poulet, für gehobene Ansprüche drei- und vierstöckige Türmchen von übereinandergestapelten Kesseli. Jedes der Bols enthält einen Gang: ein feines Reisgericht, kräftig gewürzte Fleischsauce, Erbsensauce und einen Salat mit Tomaten, Bohnen, Erbsen und Lauch.
Diese Verpflegungsart ist sinnreich und sozial: die leider übliche Kocherei mit Holzkohle dauert eine Ewigkeit, und wenn die Nahrung am frühen Nachmittag endlich lind ist, wird sie noch heiß an den Bestimmungsort verquantet. Dafür reicht die Zeit natürlich nur einmal im Tag, und drei oder gar vier Mahlzeiten muss man vergessen. Schon eine ganze Menge verstanden, nicht wahr?
Aber wie meist gegen den Schluss, kommt es noch besser. Dass man manchmal auch mir im Kesseltürmchen Nahrung brachte, nach Haus und überall hin wo ich war, selbst über den Berg, ist rührend und zeigt, dass man nicht vergessen wird, im Lande des Hungers. Dass man dazu gehört, man fühlt sich aufgenommen. Etwa wenn ich mir wieder mal ein „besseres“ Hotel leistete, eines in unserem Sinn, um auch etwas in unserem Sinn zu essen, und so fort. So saß ich – wieder einmal – in einem Speisesaal und schickte mich an, die Speisekarte zu studieren: kam da aus Collines, der Heimatfraktion unserer Familie, ein dreikäsehohes Mädchen mit einem Türmli heißer Nourriture ( Nahrung ), fragte nach dem Blanc (Weißen) der da sein müsse und kam mit den Kesseli in den Speisesaal und an meinen Tisch.
Der Weiße muss doch etwas Rechtes zu essen haben, und das gibt es ja nicht im Hotel, mochten die Hintermänner, in diesem Fall wohl Hinterfrauen denken, also bringt man es hin. Damit der Weiße nicht hungern muss, wie sie es tun. Und das Hotel duldet es. Soll man sich da schämen, schmunzeln oder weinen vor Rührung, ob so viel Vorsorge? Und glauben Sie nicht, liebe Leser, ich hätte eine Ausnahme geschildert. Die meisten Haiti-Menschen sind so – selbst wenn sie nicht lesen und schreiben können, selbst wenn du ihnen nichts gibst dafür. Sie lassen dich nie im Stich, sie schützen und umsorgen dich – ich fühlte mich niemals irgendwo sicherer!





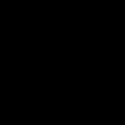

































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!