 Anfangs schnurrte der Motor gleichmäßig vor sich hin, und da David zusätzlich Segel gesetzt hatte, machten wir ganz schön Fahrt. Wir befanden uns alle in Hochstimmung. Waren die Wellen anfangs noch mäßig und verursachten ein angenehmes Wiegen des Bootes, so wuchsen sie zu meterhohen Wellenbergen, als kein Land mehr in Sicht war, und wir uns auf offener See befanden. Das Boot wurde dadurch entsprechend stark durchgerüttelt. Es erwischte mich von einer Sekunde zur anderen. Mir gelang es gerade noch, unsere Kajüte zu erreichen, wo die vom Apotheker so angepriesenen Reisetabletten gegen Seekrankheit, die ich kurz zuvor eingenommen hatte, ihren Weg rückwärts antraten.
Anfangs schnurrte der Motor gleichmäßig vor sich hin, und da David zusätzlich Segel gesetzt hatte, machten wir ganz schön Fahrt. Wir befanden uns alle in Hochstimmung. Waren die Wellen anfangs noch mäßig und verursachten ein angenehmes Wiegen des Bootes, so wuchsen sie zu meterhohen Wellenbergen, als kein Land mehr in Sicht war, und wir uns auf offener See befanden. Das Boot wurde dadurch entsprechend stark durchgerüttelt. Es erwischte mich von einer Sekunde zur anderen. Mir gelang es gerade noch, unsere Kajüte zu erreichen, wo die vom Apotheker so angepriesenen Reisetabletten gegen Seekrankheit, die ich kurz zuvor eingenommen hatte, ihren Weg rückwärts antraten.
Die Nacht verbrachte ich fast ausschließlich auf der Minitoilette. Ich legte mich nur für kurze Zeit immer wieder nieder, weil ich mich unendlich elend und erschöpft fühlte. Erschwerend kam hinzu, dass in der Nacht der Motor erneut ausfiel und damit auch wieder die gesamte Elektrizität an Bord. Das Boot schlingerte so heftig, dass ich auf dem Weg zur Toilette in der Dunkelheit mehrfach gegen irgendwelche Möbel geschleudert wurde. Ich kam mir vor, als befände ich mich in einer Waschmaschine beim Schleudergang. Etwas besser wurde es erst im Morgengrauen, als in meinem Magen anscheinend völlige Leere herrschte, und das Tageslicht wieder etwas Trost spendete.
Als ich mich in der Frühe an Deck quälte, begriff ich erst das volle Ausmaß der ganzen Misere, in der wir uns befanden. Der Motor hatte seinen Geist erneut aufgegeben, und ein gewaltiger Sturm braute sich zusammen. Noch nie in meinem Leben hatte ich derart hohe Wellen gesehen, und schon gar nicht in der Karibik für möglich gehalten. Die Wassermassen waren haushoch und donnerten von allen Richtungen auf uns ein. Das Meer bestand nur noch aus riesigen brodelnden Wellenbergen über die hinweg man nicht mehr die Weite des Meeres erblicken konnte. Das sonst türkisblaue Wasser in dem sich normalerweise die Sonne glitzernd an der Oberfläche spiegelte, war zu einer braunen gurgelnden Masse geworden. Jeden Augenblick, so dachte ich, schluckt uns so eine Riesenwelle. Meine verzweifelte Hoffnung, diesen Sturm zu überstehen, schwand mehr und mehr. Ich war wie gelähmt vor Todesangst und dem Gefühl der Ohnmacht. David erklärte uns, wir seien ziemlich manövrierunfähig, was ihn jedoch in seinem offensichtlich stark angetrunkenen Zustand nicht sehr beeindruckte. Egal nach welcher Seite ich auch Ausschau hielt, ich erblickte in den nächsten Stunden weder Land, noch ein anderes Schiff. Im Übrigen fühlte ich mich immer noch derart elend, dass ich nur liegen konnte. Mir tat unser Hund unendlich leid, der still auf seinem Plätzchen neben meinem Bett verharrte und mich Hilfe suchend anblickte. Und so verlebten wir eine weitere schlimme Nacht, in der mein Mann David am Steuer immer wieder ablöste, damit dieser seinen Rausch ausschlafen konnte, denn die Rumflasche hatte er bis jetzt nicht aus der Hand gegeben.
Nicht nur die fatale Situation in der wir uns befanden machte mir Angst. Hinzu kam auch noch, dass ich mich vor David, wenn er betrunken war, fürchten musste. Die Kajüte, die mein Mann und ich bewohnten, konnte man nicht verriegeln, denn es gab eine Verbindungstür zum Maschinenraum. Während der Zeit, in der Joe das Steuer übernehmen musste, lag ich deshalb ständig auf der Lauer. Seltsamerweise hatte nämlich immer genau dann David irgendwas im Maschinenraum zu schaffen. Wir trauten diesem David nicht mehr. Er war jetzt nur noch betrunken und unberechenbar. Aus diesem Grund hatte mein Mann mir einen Holzknüppel besorgt, mit dem ich mich wehren sollte, falls David in unsere Kajüte eindringt und aufdringlich werden sollte.
Irgendwann stellten wir mit Entsetzen fest, dass weder Funk noch Schwimmwesten oder dergleichen an Bord waren. Ich hatte in meinem Innersten mit meinem Leben eigentlich schon abgeschlossen. Schlimm war für mich auch der Gedanke, dass kein Mensch wusste, wo genau wir uns befanden. Wären wir in akute Seenot geraten, hätte niemand uns finden können. Erst nach zwei Tagen, die so ziemlich zu den schlimmsten meines Lebens zählten, ließ der Sturm nach, so dass wir in der Lage waren, auf der kleinen Insel Carriacou, die zu der Inselgruppe der „Kleinen Grenadinen“ gehört, anzulegen. Es war ein unglaublich gutes Gefühl, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Unser tapferer Hund hatte sich die ganze Zeit nicht von seinem Platz unter Deck entfernen können, da er oben mit Sicherheit von Bord gespült worden wäre. Als Belohnung für sein Ausharren unternahmen wir mit ihm natürlich als erstes einen langen Spaziergang am Strand, und hatten somit gleichzeitig Gelegenheit, die Insel ein wenig zu erkunden.





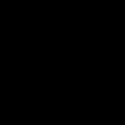

































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!