 Meine Frau Rosita telefoniert gern und lang. Das ist wieder möglich, und die Menschen drüben in Haïti, das sich die Karibikinsel Hispaniola mit der Dominikanischen Republik teilt, erzählen gern und viel. Trotz extremer Armut hat ja jeder sein Handy. Von einer „Nabelschnur zur Welt“ kann man nicht mehr sprechen, es funzt ja alles schnurlos. Aber nicht wellenlos. Nicht nur ein Handy am Ohr ist eine Welle, auch Klönen ist in. „Hunger“ als Motiv zieht nicht mehr, „kein Haus“ tönt schon besser, am verbreitetsten ist einfach „kein Geld. Könntest Du mir etwas schicken“. Am besten zieht „ein Dictionnaire“, oder sonst ein einleuchtendes Bedürfnis.
Meine Frau Rosita telefoniert gern und lang. Das ist wieder möglich, und die Menschen drüben in Haïti, das sich die Karibikinsel Hispaniola mit der Dominikanischen Republik teilt, erzählen gern und viel. Trotz extremer Armut hat ja jeder sein Handy. Von einer „Nabelschnur zur Welt“ kann man nicht mehr sprechen, es funzt ja alles schnurlos. Aber nicht wellenlos. Nicht nur ein Handy am Ohr ist eine Welle, auch Klönen ist in. „Hunger“ als Motiv zieht nicht mehr, „kein Haus“ tönt schon besser, am verbreitetsten ist einfach „kein Geld. Könntest Du mir etwas schicken“. Am besten zieht „ein Dictionnaire“, oder sonst ein einleuchtendes Bedürfnis.
Zwischen Zweckgeheul und wahrer Dringlichkeit zu unterscheiden, ist fast unmöglich. Wenn die Telefonate der Armen, der Vertrauten, die Meldungen aus den Medien nicht stimmen? Übertrieben sind und nur etwas bewirken wollen? Das hab ich mir auch schon überlegt, und deshalb gehe ich bald hin, am 8.Mai, um selber zu sehen und ohne Handy zu hören, es ist höchste Zeit. Ich mache mir keine Illusionen, wie schwierig das ist. Wahrheit und Gerechtigkeit zu finden, Not zu messen. Und dazu kommt, dass mir auch nicht mehr viel bleibt, um zu verschenken. Der „Riche Blanc“, der reiche Weiße, ist vergangen.
Man wird mich wieder „Blanc dur“ nennen, den „harten Weißen“, ich sei knauserig. Ich werde nur noch zufällig Almosen geben können, etwa wenn man die Schwere der Behinderung sieht, einem Unijambe, einem Einbeinigen oder Beinlosen, und so. Ich werde „man“, und man wird hart, schaut mehrmals hin wem man hilft. Sonst verhungert man bald selbst, und kann überhaupt nicht mehr helfen. In der jetzigen Situation sowieso.
Die Stehlerei da drüben stinkt ja auch zum Himmel, noch mehr als der ekelhafte Gestank des „Fatra“-, der Abfall- und der Leichenberge, den der Wind während der zehn Biwaktage tausend Meter aus der Stadt bis zu uns herauftragen konnte und der uns kotzen, pardon, vomieren machte. Wenn ich vom „Gestank“ des Stehlens spreche, meine ich das sinnbildlich, doch noch lieber würde ich vom „Gestänk“ sprechen, das die Leute machen. Mit dem Handy, und auch ohne. Denn sie haben ja nichts mehr zu schwatzen als alles in den Schmutz zu ziehen, aber auch alles, und nichts Gutes an den Hilfeleistungen zu lassen.
Natürlich ist das schwer zu messen, und dumme Gerüchte kann man immer plattwalzen. Aber so wie ich ein Beispiel in Macht und Ohnmacht der Medien schilderte, wie schon am zweiten Tag in unserem Freilandbiwak ein UN-Fahrzeug zur „Brücke“ hinaufschnurrte, dem Endpunkt der befahrbaren Piste, und uns Mais, Reis, Öl und Wasser für ein paar Tage brachte, kann ich den Hilfswerken nur das beste Zeugnis ausstellen und lasse die Medien nörgeln und das Gegenteil behaupten. Auch ein Kollege schrieb: „So konnte ich in den Medien, seit dem Beben bis heute, selten einmal etwas Gutes hören, selten die wohlwollende Anerkennung einer Leistung oder Institution. So werden von den Arbeiten der Sammelwerke vorwiegend die Fälle von Plünderung, Diebstahl und Veruntreuung hervorgehoben, und es entsteht der Eindruck, diese seien normal. Die Medien wollen lieber meckern, das bringt mehr Zuschauer.“
So verhält es sich so ziemlich bei allen Informationen. Gestänke und Gerüchte sind etwas Ähnliches. Stänkern scheint mehr zu bringen als die Wahrheit. Die Stänkerer sind ubiquitär, will heißen allenthalben, und destruktiv. Im Augenblick muss man noch Bösewichte in Kauf nehmen. Solang die in der Minderheit und die guten Geister in der Mehrheit sind, geht es zwar langsamer, aber immerhin stetig aufwärts. Natürlich wird gestohlen, aber ich denke immer weniger, und vor allem glaub ich, das muss man in Kauf nehmen. Wenn Sie es besser wissen, schreiben Sie mir, und viel Glück!





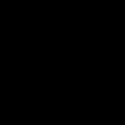

































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!