Haiti als Republik der Hilfswerke sei eine Horrorvision, so hat der Tages-Anzeiger am 6.November sein Interview mit dem Leiter des Albert Schweitzer-Spitals, dem Schweizer Rolf Maibach getitelt. Das 1956 gegründete Spital mit seinen 130 Betten liegt inmitten des Landes, im Artibonite, in dessen oberstem Teil Mitte Oktober auch die Cholera ausbrach. Keineswegs wegen der Nähe dieses Spitals, wohl eher wegen der Nachbarschaft eines nepalesischen Truppenlagers. In Nepal wütete gerade derselbe Bazillus wie später in Haiti. Aber dank der Spitalnähe konnte anfänglich die weitere Ausbreitung der Seuche reduziert, wenn auch nicht gestoppt werden. Das Spital machte sich nach dem Erdbeben einen besonderen Namen als Amputationszentrum und Prothesenfabrik. 6000 Menschen mussten amputiert werden. Über 600 Prothesen sind fabriziert, pro Woche kommen 40 dazu; das ist ein Rekord.

Trotz Erdbeben, Cholera und Hurrikan-Terror wollen viele Ärzte nicht weg aus Haiti. Sie erleben, was das für ein großartiges Volk ist. Kein Volk improvisiere besser. Sie hätten die Gabe, ständig mit lebensbedrohenden Problemen, wie Erdbeben, Wirbelstürmen und Seuchen umzugehen. Gerade dieses Wochenende gab es ja alle drei gleichzeitig. Dass die Haiti-Leute alles mit Magie und okkulten Kräften erklären, ist begreiflich und ändert nichts an der Sache. Sie sind einfach da und leben von Augenblick zu Augenblick, und nach ein paar Minuten des Schocks lachen, singen und tanzen sie wieder.
Rolf Maibach ist ein Schweizer Kinderarzt und arbeitet seit 14 Jahren im Spital. Er hat sich eine Wegreise nie überlegt, trotz Wirbelstürmen, Erdbeben und Cholera. Kein Volk improvisiere besser, sagt er, und er hat recht. Er mache sich wenig Gedanken, wieso es immer die Ärmsten treffe, die Ärzte seien einfach dort und helfen von Katastrophe zu Katastrophe. Er idealisiere Haiti mitnichten. Aber das Land färbe auf ihn ab. Er bewundere die Menschen, wie sie mit so wenig das Leben meistern würden. Auch ich habe schon mehrmals geschrieben, kein Volk hätte eine solche Lebenskraft, und habe wohl dasselbe gemeint. Auch ich habe am deutschen Fernsehen gesagt, als mich Frank Elstner danach fragte, ob ich wirklich wieder zurückkehren wolle in dieses Land der Katastrophen, nie könnte ich diese Menschen verlassen, ich gehöre einfach zu ihnen.
Der große Arzt sagt, die Ärmsten seien vielfach vom Erdbeben verschont geblieben, weil sie in leichten Hütten lebten. Der Cholera hingegen seien gerade sie am ungeschütztesten ausgeliefert. Die Seuche treffe deshalb vor allem Schwache und Unterernährte. Inzwischen sei die Lage stabiler, sein Spital habe etwa 20 Fälle pro Tag, nicht mehr Hunderte wie vor zwei Wochen. Die Gefahr liege jetzt darin, dass die Cholera auf die großen Städte übergreife. An den Hängen darüber wohnen die Bourgois. Die sind nicht gefährdet; für sie gehört Wasser und Hygiene zum Alltag.
Eine typische Geschichte ist die von Naomie. „Die 13-Jährige lag stundenlang unter Trümmern. Die Eltern starben, und ihr musste man das zerquetschte Bein amputieren. Naomie war schüchtern, lernte aber rasch, mit ihrem neuen Bein rumzugehen. Sie blühte auf und steckte mit ihrer Fröhlichkeit die anderen Amputierten an. Die Prothesenfabrik ist der positivste Ort in ganz Haïti. Das ist kein Klischee, die Leute lachen und strahlen, wenn sie wieder laufen können.“
Rolf Maibach profitiert von seinen Einsätzen in Haïti mehr, als er geben kann, erzählt er dem Tagi. Zum Beispiel, wenn ein schwer krankes Kind, bei dem man alle Hoffnung schon aufgegeben hatte, einen anstrahle, weil es wider Erwarten doch gesund wurde. „Die Haitianer können nicht gut Danke sagen, aber sie können den Dank ausdrücken, indem sie einen spontan umarmen. Diese Gefühlswellen, zumal über die Rassengrenzen hinweg, sind einzigartig. Nur helfen zu wollen, reicht nicht. Wenn man nur gibt, ist man in einer Woche leer. Wenn man hingegen etwas für sich macht, hat man Kraft und Energie. Das ist zwar eine Art Egoismus, aber ein spezieller Egoismus. Es geht nicht um Franken und Rappen. Und trotzdem werde ich mit jedem Tag in Haiti reicher“.
Dies entspricht auch genau meinen Gefühlen. Ich habe ja bekanntlich bei Einheimischen im Montagnes Noires, den Schwarzen Bergen ob Pétion-Ville, Unterschlupf gefunden. Ich kann in der nächsten Umgebung beobachten, wie viele Wohnungen in europäischem Stil erbaut werden, und zu welchen Preisen sie vermietet werden – Preise, die sich Einheimische nie leisten könnten. Sie können wohl mal in die tausende von US$s gehen, im Monat, wohlverstanden. Und teils erst noch mit 6 oder 12 Monaten Vorauszahlung. Dasselbe auch in den neuen Einkaufsmärkten, Giant etc., wo für die Hilfswerkbosse und deren Chauffeure und Ehefrauen alles zu haben ist wie zu Hause, nur zu noch höheren Preisen, für Einheimische nie erschwinglich.
Die X-tausend Hilfswerke haben die Normalität zerstört. Die Spitäler bekommen kaum mehr einheimische Ärzte, weil die zu teuer geworden sind. Amis und übrige Helferlinge überzahlen das Personal, sodass sich die Institutionen einheimische Arbeitskräfte nicht mehr leisten können. Die Ausländer kennen das übliche Lohnniveau nicht und produzieren eine ungesunde Lohnschere, schaffen ein für dieses Land ungewohntes Lohnniveau und dadurch Arbeitsprobleme nach deren Abzug.
Die Republik der Hilfswerke ist keine Horrorvision mehr, sie ist Tatsache geworden. Hilfe ist zu einer Industrie geworden. Es gibt die Pédicure und die Visagistin, den Schuhputzer und den Taschenträger, und ein paar Kilometer weiter oben in den Bergen die Kinder, die verhungern. Die Hilfswerke sind in vielen Städten die einzigen Arbeitgeber für die Haitianer, niemand mehr, der anderswo arbeitet. Entweder man bringt es zum Helfer, oder man bleibt als Hilfeempfänger zementiert. Wahrscheinlich auf immer. Wenn man die berühmte Katastrophenstadt Gonaïves durchwandert, sind fast alle Häuser mit Tafeln von Hilfswerken und Care-Firmen angeschrieben, meist natürlich in Englisch. Die haben Generaldirektoren oder mindestens Direktoren, die sich um die Geschicke der Stadt und des Staates streiten. Koordination und Zusammenarbeit gibt es kaum. Es stehen protzige Geländewagen vor den Mauern, mit englischen Firmennamen, Logos und Abkürzungen, bei diesen Hilfswerken kann man eher von Großunternehmen sprechen. Man kann fast sagen, dass sich ein gewisser Wohlstand entwickelt hat, für die einen, bis heute immer noch nachhaltig – wie lang das so bleibt, das weiß niemand.
Auch die Medienlandschaft hat sich gewandelt. Da funkeln die großen Plasma- und LED-Bildschirme in prallem Sonnenlicht ihre Werbespots auf die Menschen herunter. Nur Meter unter ihnen die Ausrufer und Sänger, die ihre Parolen oder Gebete per Megaphon über die Landschaft schreien. Das Megaphon ist sogar in die Dörfer und Berge eingekehrt, fast wie ein Alphorn, nur weniger klangvoll, singt es Gebete über das Land, manchmal auch ur-afrikanische oder sogar pentatonisch-chinesische Konserven und Gesänge, die die Luft erfüllen – , ein regelrechter Ohrenschmaus. Auch das Handy ist ein wichtiges Medium geworden. Anweisungen an die breite Bevölkerung erfolgen per Handy oder SMS, sogar bei Katastrophen. Jeder besitzt eines oder mehrere; selbst wenn er dafür aufs Essen verzichten muss. Auch Fernsehen und Radio spielen eine enorme Rolle. Soeben hat am Radio der Spitalboss von Hinche dringend um Leichensäcke gebeten, er bewältige im Tag 27 Choleratote und könne die Leichen nicht mehr entsorgen.
Nachtrag 16.11.: Update
1034 Choleratote, 16.799 Hospitalisierte
Fast täglich Erdbeben irgendwo im Land, heute in Nippes, Hauseinstürze und viele verletzte Kinder
in Cap und Cayes Unruhen, Polizeistation angezündet, das Volk verlangt die Ausweisung des nepalesischen Blauhelme, die als Cholera-Schuldige angesehen werden.
Um diese traurigen Aktualitäten noch unterzubringen, habe ich die Kolumne vom 19.11. verfrüht, schon heute, am 15.11. publiziert.




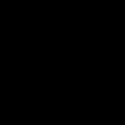

































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!