Guayaquil ist die größte Stadt Ecuadors und liegt an der Südwestküste des Landes, zwischen den Flüssen „Guayas“ und „Estero Salado“. Mehrmals habe ich dort gehört: „Guayaquil, entweder man findet es schrecklich, oder charmant“. Wenn man die neuklassische, imposante Architektur und das ganztägige Treiben auf den Straßen im Zentrum nebst Abgasen, Krach und der relativ hohen Kriminalitätsrate trotzdem genießen kann, gehört man wohl eher zu Letzteren. Seit der Jahrtausendwende hat man viel getan, um den schlechten Ruf der Stadt aufzupolieren. So folgten mehrere urbane Großprojekte: die Uferböschungen im Zentrum wurden zu Flanaden, andere Teile Stadt wurden durch Schnellstraßen miteinander verbunden, im Flussbett werden derzeitig mehrere künstliche Inseln aufgeschüttet um mehr (Luxus-)Wohnräume zu schaffen.

Nicht nur im Zentrum hin tut sich Vieles, sondern auch in den Nachbarschaften, die etwas abseits liegen. So zum Beispiel wird der gesamte Bezirk in dem Nelly wohnt, komplett asphaltiert. Somit können die Busse, die bis jetzt nur quasi vor dem Eingang halt machen, ab 2011 passieren. Wenn man die Gemeinde kennt, merkt man sehr schnell, dass das eine wirkliche Erleichterung darstellt, auch wenn das nur eine der vielen nötigen Verbesserungen ist.
Nelly ist Afroecuatorianerin, so wie praktisch alle ihre Nachbarn, und genau wie Nelly müssen sie tagtäglich mit dem strukturellen Rassismus Ecuadors leben. Übersetzt heisst das: etwa 70% der Afroecuatorianer leben unter der Armutsgrenze, im Vergleich zu 61% der Gesamtbevölkerung. 12% der Afroecuatorianer befinden sich in der Arbeitslosigkeit – die Gesamtarbeitslosigkeitsrate beträgt 10%. Schlimmer sind die Zahlen in Sachen Bildung: die durchschnittliche Teilnahme afroecuatorianischer Kinder an der schulischen Ausbildung liegt bei 6,15 Jahren, die der Weißen Bevölkerung bei 9,2 Jahren. Kann man da noch von gleichen Möglichkeiten sprechen? Und so ist das Leben der Afro-Gemeinde im Land durch Armut und vor allem Perspektivlosigkeit geprägt.
Allerdings gibt es Beispiele wie Nelly, die durch ihre positive Energie und ihre unglaubliche Tatkraft diesen Teufelskreis durchbrechen. Nelly arbeitet und studiert „nebenbei“ Kontoführung, um hoffentlich nach dem Studium einen guten Job zu bekommen. „Ich brauche mindestens 1.500 Dollar im Monat“ sagt sie. Ein durchschnittliches Gehalt beträgt etwa 500 Dollar. Warum sie so hoch strebt, versteht man wenn man ihre Lebensgeschichte kennt. Nellys Vater starb, als sie drei Jahre alt war. Ihre Mutter hat ihr Leben der Arbeit gewidmet, um ihren Kindern und anderen Familienmitgliedern eine Schulbildung und das tägliche Essen zu ermöglichen. Als sie noch ein Kind war, betete Nelly oft, dass sie ihrer Mutter eines Tages das alles zurückgeben könnte und ihre Mutter nicht mehr so viel schuften müsse. Das 1.500-Dollar-Gehalt im Monat soll also nicht nur für Nelly reichen, sondern auch für ihre Mutter und für jeden Teil der Familie, der es braucht.
Abgesehen von den Geldnöten ist es vor allem die Perspektivlosigkeit der Jugend, die dazu führt, dass Drogenkriminalität und Alkoholismus ständig steigen.
Vor ein paar Jahren wurde Nelly zu einem einjährigen Weiterbildungsprogramm zur Stärkung der Organizationskapazität afroamerikanischer Gemeinden eingeladen. Nach dem Abschluss war für sie klar, dass sie ihre Nachbarn, Freunde und Familie dazu bringen wollte, neue Wege für die Zukunft ihrer Gemeinde zu gestalten. In Nellys Fall wurde daraus eine komplette Umstrukturierung der Nachbarschaftsbeziehungen durch selbstorganisierte und selbstfinanzierte Projekte, die in Gemeinschaft vor allem den Jugendlichen des Bezirks erarbeitet werden und in den letzten Jahren langsam gewachsen sind. Nelly und ihre Familie haben somit mehrere Projekte aus dem Boden gestampft, die vor allem die Möglichkeiten der Jugend auf dem Arbeitsmarkt stärken sollen, zum Beispiel Weiterbildungen und Hilfe bei der Gründung von selbstständigen Unternehmen oder Kooperativen. Aber abgesehen davon ist es der Gruppe vor allem wichtig, die Nachbarn zusammenzubringen um die Solidarität zu fördern. Deswegen organisieren sie Events, wie zum Beispiel Festivals, solidarische Zusammentreffen, kulturelle Kurse, Informationsrunden über Gesundheit, und vieles mehr.
Dabei sind sie größtenteils unabhängig von äußerer finanzieller Unterstützung geblieben. Das hat vor allem zwei Vorteile: zum Einen wird die Gemeinde dadurch wesentlich mehr in der Planung und Durchführung der Projekte involviert. Zum Anderen wird eine strukturelle Abhängigkeit von Geldern von außen vermieden, was wiederum zur Nachhaltigkeit der Organisation beiträgt. So werden durch Nachbarschaftsbingos und andere Aktivitäten Gelder über das ganze Jahr gesammelt, um für das Darauffolgende die Gemeindearbeit sichern zu können.
Trotzdem ist Nelly der internationalen Entwicklungskooperation grundsätzlich positiv gegenübergestellt. „Die internationalen Ressourcen haben uns viel geholfen, weil wir mit vielen Projekten vorangekommen sind, die die Regierung nicht berücksichtigt“. Außerdem glaubt sie, dass durch den Austausch und die Ausbildung von Community Leaders wirkliche Chancen geschaffen werden, um den Protagonismus der sonst als „marginalisiert“ bezeichneten Gemeinden zu stärken.
Jedoch ist es Aufgabe der gesamten Gesellschaft, solche Prozesse zu unterstützen, zu begleiten und den Rassismus in einem solch multiethnischen Land wie Ecuador zu überwinden.




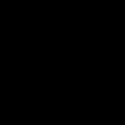

































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!