In der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts steht die katholische Kirche in Brasilien, dem größten katholischen Land der Welt, vor Herausforderungen, die so groß sind wie ihre Bedeutung in der brasilianischen Gesellschaft. Dies sind Themen, die Papst Franziskus in gewisser Weise versucht hat, anzugehen. Aber sie werden dem nächsten Pontifex als Vermächtnis bleiben. Die katholische Präsenz im größten Land Südamerikas ist trotz des Vormarschs der evangelikalen Kirchen, die ihre Vorherrschaft bedrohen, nach wie vor sehr stark. Laut einer im Februar von dem Theologen und Philosophen Fernando Altemeyer Junior, Professor an der Päpstlichen Katholischen Universität von São Paulo (PUC-SP), durchgeführten Untersuchung gibt es 12.618 Pfarreien im ganzen Land. Mit 490 lebenden Bischöfen, von denen 318 aktiv sind, hat Brasilien den größten Episkopat der Welt – an zweiter Stelle stehen die Vereinigten Staaten mit 446 Bischöfen (276 aktiv); an dritter Stelle folögt Italien mit 397 (227 aktiv). Die katholische Kirche ist seit der Ankunft der Portugiesen in der brasilianischen Geschichte präsent und hat zur kulturellen, künstlerischen, sozialen und administrativen Entwicklung des Landes beigetragen.
Brasilien hat auch die viertgrößte Anzahl von Kardinälen in der Welt, gleichauf mit Frankreich und Argentinien, mit insgesamt acht (aber nur sieben brasilianische Kardinäle sind Wahlmänner im Konklave, das den neuen Papst wählen wird). Dies ist die zweithöchste Position in der kirchlichen Hierarchie, nur noch hinter dem Papst selbst. Italien liegt mit insgesamt 51 Kardinälen an der Spitze, gefolgt von den Vereinigten Staaten (17) und Spanien (13). All diese Größe hat jedoch in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung verloren, was nach Ansicht von Experten auf zwei diametral entgegengesetzte Entwicklungen zurückzuführen ist: zum einen auf den vermeintlichen Verlust des Einflusses der Religion auf die verschiedenen Lebensbereiche und zum anderen auf das Wachstum des Evangelikalismus. „Verliert die katholische Kirche Gläubige? Statistisch gesehen, ja. Aber wir müssen dieses globale Phänomen verstehen“, sagt der Vatikanist Filipe Domingues, Professor an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und Direktor des Laienzentrums, ebenfalls in Rom.
„Dass die Kirche nicht mehr in der Lage ist, mit den Menschen zu sprechen, ist Teil des Problems, aber es gibt auch einen Druck von außen. Alle traditionellen Institutionen sind in der Krise.“ Gleichzeitig leidet die katholische Kirche unter Priestermangel und scheint in einem extrem polarisierten politischen Kontext noch immer nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden zu haben, um zu wichtigen Themen des 21. Jahrhunderts Stellung zu beziehen, betont der Theologe und Historiker Gerson Leite de Moraes, Professor an der Mackenzie Presbyterian University. „Der Vatikan kann nicht viel tun, weil es sich um eine sehr kristallisierte Bürokratie handelt, die Jahrzehnte für jede bedeutende Veränderung braucht“, kommentiert der Theologe, Philosoph und Journalist Domingos Zamagna, Professor an der PUC-SP. „Die Person des Papstes hingegen kann einen enormen missionarischen Nachhall in der religiösen Welt haben, auch wenn es in der Kirche weiterhin große Kontingente von Laien, Priestern und Bischöfen gibt, die die Hirtenschaft von Papst Franziskus missbilligen und sogar bekämpfen“, so Zamagna weiter. „Was der Vatikan tun kann, ist, die Bemühungen der Ortskirchen um eine neue Dynamik in der Kirche zu unterstützen und anzuregen. Es sind die Ortskirchen, die die pastorale Realität kennen.“
Verlust von Gläubigen
Nach den Daten der Volkszählung des brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik (IBGE) machten die Katholiken im Jahr 2000 74 Prozent der brasilianischen Bevölkerung aus. Zehn Jahre später waren es nur noch 65 Prozent. Hinzu kommt, dass viele derjenigen, die sich als Katholiken bezeichnen, „nur statistisch“ Katholiken sind, ohne am religiösen Leben teilzunehmen. „Die Existenz der nicht praktizierenden Katholiken ist ein brasilianisches Kulturthema“, sagt die Anthropologin und Historikerin Lidice Meyer Pinto Ribeiro, Professorin an der Universität Lusófona in Portugal. „Unsere Kolonialisierung hatte einen starken Einfluss der katholischen Werte, der in den Brasilianern eine ‚katholische Seele‘, aber nicht die Verpflichtung zum Kirchenbesuch hervorbrachte.“ Während die Zahl der Katholiken im Land zurückging, stieg die Zahl der evangelischen Christen zwischen 2000 und 2010 von 15 Prozent auf 22 Prozent. Die aktuellsten Zahlen aus der Volkszählung 2022 werden erst im Juni dieses Jahres veröffentlicht.
Eine neuere Umfrage von Datafolha aus dem Jahr 2020 zeigt, dass sich damals die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung als katholisch bezeichnete, während 31 Prozent sich als evangelisch bezeichneten. „Der Katholizismus verliert seine Gläubigen nicht, weil sie zu Atheisten werden, sondern weil sie ein konservativeres Christentum annehmen“, betont der Soziologe Francisco Borba Ribeiro Neto, Herausgeber der Zeitung O São Paulo, die von der Erzdiözese São Paulo herausgegeben wird. Es gibt jedoch auch Stimmen, die in die entgegengesetzte Richtung weisen und sagen, dass gerade der katholische Konservatismus der Grund für den Rückgang der Anhängerschaft ist. „Der Verlust von Gläubigen aus der katholischen Kirche und die Zunahme evangelikaler Kirchen ist meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass die katholische Kirche 34 Jahre lang von den konservativen Pontifikaten Johannes Pauls II. und Benedikts 16. regiert wurde“, sagt der Dominikanermönch und Schriftsteller Frei Betto. „Heute hat die Mehrheit des Klerus eine gemäßigte bis konservative Tendenz. Wir haben keine prominenten prophetischen Gestalten mehr, wie so viele, die sich für die Menschenrechte und die Option für die Armen eingesetzt haben.“
Laut Frei Betto fühlen sich heute „viele Gläubige aus den unteren Schichten“ nicht mehr „in den überwiegend bürgerlich geprägten Pfarreien zu Hause“. „Wenn Sie in ein Gebäude in São Paulo gehen, sind die Bewohner vielleicht Katholiken, aber der Pförtner, der Klempner, die Reinigungskräfte und die Köche sind mit Sicherheit Evangelikale“, so Betto. „Franziskus hat getan, was er konnte, um die Kirche zu erneuern, aber sie ist zu einer konservativen Körperschaft mit einem progressiven Kopf geworden.“ Fr. Betto erinnert daran, dass Franziskus zu einer „Entelitisierung“ der katholischen Kirche aufgerufen hat. „Solange dies nicht geschieht, werden wir Katholiken weiterhin Gläubige an die evangelischen Kirchen verlieren“, sagt er. Der Theologe Moraes ist der Ansicht, dass die katholische Kirche vor einer doppelten Herausforderung steht: Einerseits verliert sie ihre Vormachtstellung durch die Abwanderung der Gläubigen zu anderen Konfessionen, andererseits kann sie diejenigen, die weiterhin Katholiken sind, nicht vernachlässigen – es ist notwendig, „die Flamme des Katholizismus in dem Land, das immer noch das größte katholische Land der Welt ist, am Brennen zu halten“, betont er.
„Die evangelischen Kirchen wachsen und der Katholizismus ist ein großer Lieferant von Gläubigen. Die katholische Kirche muss das, was noch übrig ist, bewahren, um die Krise des Verlustes von Gläubigen zu stoppen“, sagt er. Für Ribeiro ist es schwierig, diese beiden Welten, die der Katholiken und die der Evangelikalen, miteinander in Einklang zu bringen. „Leider hat sich in Brasilien eine ideologische Polarität verschärft, die die Evangelikalen immer weiter von den Katholiken entfernt. Die Polarität, die es im 19. Jahrhundert gab und die allmählich nicht mehr so extrem war, kehrt mit noch größerer Kraft zurück“, analysiert er. Doch nicht alle sehen die Evangelikalen als Konkurrenten. „Das Wachstum der Pfingstbewegung ist keine Bedrohung für die katholische Kirche“, meint der Priester und Theologe Eliomar Ribeiro de Souza, nationaler Direktor des Weltweiten Gebetsnetzwerks des Papstes in Brasilien. „Es ist eine Bewegung, die aus der Freiheit des Einzelnen und der Bekehrung bestimmter Gruppen entsteht. Heute wird im Umfeld der katholischen Kirche die Art und Weise, wie Menschen ihren Glauben leben wollen, stärker respektiert.“
Neben dem Vormarsch der Evangelikalen weisen andere darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung das Interesse an jeglicher Art von Religion verloren hat oder nicht-traditionellen Glaubensformen anhängt. Das hat auch die Volkszählung gezeigt: Von 2000 bis 2010 hat Brasilien 3 Millionen Menschen hinzugewonnen, die sich als religionslos bezeichnen – das sind 8 Prozent der Bevölkerung. Es ist wichtig zu betonen, dass keine Religion nicht zwangsläufig keine Spiritualität bedeutet. Viele Menschen folgen keiner formalen Religion, sondern üben weiterhin private Formen der Religiosität aus oder halten an Überzeugungen fest, die nicht als Religionen an sich gelten. Um diese Situation umzukehren, ist nach Ansicht von Moraes eine „konsolidierte Strategie“ erforderlich, die an mehreren Fronten ansetzt: Aktionen an der Basis, charismatische Elemente, die den pfingstlichen Stil nachahmen, und eine starke Präsenz in den Medien.
Eine weitere Herausforderung, auf die Beobachter der katholischen Kirche hinweisen und die für die Beziehung zu den katholischen Gläubigen von besonderer Bedeutung ist und mit dem Verlust von Gläubigen zusammenhängt, ist der Priestermangel in Brasilien. Eine unmittelbare Folge davon sei, dass nicht jeder, der potenziell Seelsorge im Katholizismus suchen würde, diese auch erhalten könne – eine Nachfrage, die letztlich von anderen religiösen Konfessionen aufgefangen würde, betont Bruder Betto. Laut einer 2018 veröffentlichten Studie des Zentrums für religiöse Statistiken und soziale Untersuchungen (Ceris), einer inzwischen aufgelösten Stiftung, die mit der Nationalen Bischofskonferenz Brasiliens (CNBB), dem wichtigsten lokalen Gremium der Kirche, verbunden war, gab es 27.300 Priester im ganzen Land, also durchschnittlich einen pro 7.800 Einwohner. Im Vergleich dazu kam in Italien ein Priester auf tausend Einwohner. In der Studie wird auch darauf hingewiesen, dass mindestens 20.000 weitere Priester benötigt würden, um alle katholischen Gemeinden im Land zu versorgen. Die in dem Bericht befragten Experten sind der Ansicht, dass die heutige Situation nicht anders ist.
„Wenn wir die Zahl der Priester in Brasilien mit der anderer Länder vergleichen, können wir sagen, dass es in unserem Land einen Mangel an Priestern gibt“, räumt Zamagna ein. Seiner Ansicht nach muss das Verhältnis von Priestern zur Bevölkerung jedoch keiner exakten Regel folgen, da verschiedene Regionen unterschiedliche Bedürfnisse haben können. Für Souza ist eine Erneuerung des Klerus notwendig – und dazu gehört auch ein Mentalitätswandel. „Es gibt zu viele junge Menschen, die in die Seminare gehen und nach Schemata ausgebildet werden, die für eine sich verändernde Welt zu alt sind“, argumentiert Souza. „Die Folge davon sind Priester, die nicht wissen, wie sie den Menschen von heute dienen können.“ Während des Pontifikats von Papst Franziskus wurde eine Reihe von Maßnahmen geprüft, um dieses Defizit auszugleichen. Auf der Amazonas-Synode 2019 wurde zum Beispiel die Möglichkeit erörtert, verheiratete Männer zu weihen. Der Vorschlag wurde nicht angenommen.


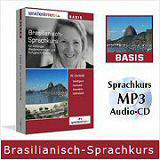





































 © 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von
Leider kein Kommentar vorhanden!